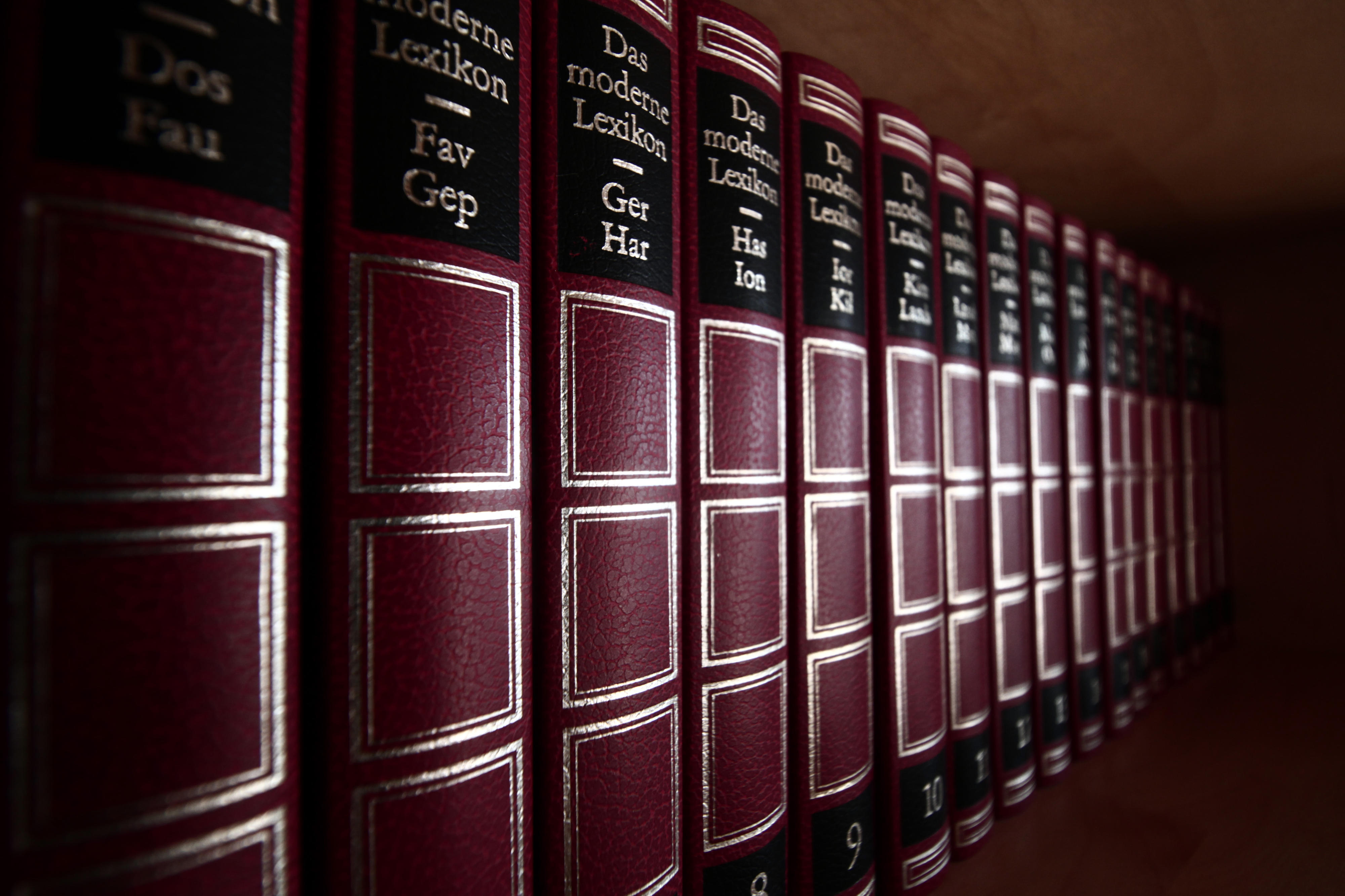Symbolbild: Mehrer Bände einer Lexikonausgabe aus den 1970er Jahren (Bildausschnitt)
Urheberrecht© Birgit, via flickr, CC BY-NC 2.0
Lexikon der Entwicklungspolitik
Abfälle im Wohnumfeld beeinträchtigen die Siedlungshygiene und stellen besondere Gesundheitsrisiken dar. Gerade ärmere Bevölkerungsschichten in informellen Siedlungen sind hiervon betroffen. Eine nachhaltige (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Abfallwirtschaft erfüllt wichtige entwicklungspolitische Ziele, denn sie ist von zentraler Bedeutung für:
- die Gesundheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die Lebensqualität und das Einkommen von Menschen, insbesondere der armen und benachteiligten Bevölkerung,
- den Schutz der Umwelt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und die effiziente Nutzung von natürlichen Ressourcen sowie
- die Minderung von Treibhausgasen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und damit für den Klimaschutz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) unterstützt ihre Partner dabei, die Chancen einer geordneten Abfallwirtschaft zu nutzen und eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Das bedeutet: Abfall sollte so weit wie möglich vermieden werden. Wo dies nicht gelingt, sollte er als Ressource wiederverwertet werden. Der Restabfall muss ohne Gefahr für Menschen und Umwelt entsorgt werden.
Mehr zum Thema Abfallwirtschaft lesen Sie hier.
Abnahmegarantien für Impfstoffe (Advanced Market Commitments, AMC) sollen die Erforschung, Entwicklung und Verfügbarkeit von Impfstoffen in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verbessern und dadurch die Verbreitung von Infektionskrankheiten eindämmen. Das Modell sieht vor, dass Staaten, internationale Organisationen und Stiftungen die Forschung von Pharmaunternehmen subventionieren und ihnen die Abnahme neu entwickelter Impfstoffe zu einem vorab festgelegten Preis garantieren.
2007 startete ein Pilotprojekt zur Bereitstellung von Impfstoffen gegen Pneumokokken (Verursacher von schwerwiegenden Infektionskrankheiten, insbesondere der Atemwege und Hirnhautentzündungen). Deutschland beteiligt sich bislang nicht an den Abnahmegarantien, da zum Start dieses Projekts zahlreiche offene Fragen bestanden, etwa zur Preisgestaltung und zur Bereitstellung der Impfstoffe nach Auslaufen der Abnahmegarantien. 2015 erfolgte eine erste Auswertung des Pilotprojekts, es wird weiter fortgesetzt.
Das könnte Sie auch interessieren:
Ein zentrales Anliegen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist es, den Zugang zu genetischen Ressourcen zu regeln und die sich aus ihrer Nutzung ergebenden Gewinne gerecht aufzuteilen (englisch: Access and Benefit Sharing, ABS). Um für dieses Ziel eine rechtsverbindliche Grundlage zu schaffen, wurde auf der 10. Vertragsstaatenkonferenz der CBD das Nagoya-Protokoll verabschiedet.
Das Protokoll sieht vor, dass einerseits der Zugang („Access“) zu genetischen Ressourcen eines Landes rechtssicher gestaltet werden soll. Andererseits sollen die Herkunftsländer solcher Ressourcen an den Gewinnen, die ein Nutzer erzielt (beispielsweise bei der Vermarktung von Kosmetika, Medikamenten oder Nahrungsmitteln), gerecht beteiligt werden („Benefit Sharing“). Somit dient das Protokoll auch dazu, Biopiraterie zu unterbinden.
Das könnte Sie auch interessieren:
Der African Peer Review Mechanism (APRM) dient afrikanischen Staaten als Instrument zur gegenseitigen Beratung, Beurteilung und Unterstützung in Fragen der guten Regierungsführung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Dahinter steht der Anspruch, eigene Antworten auf die wichtigsten Probleme des Kontinents zu formulieren. Im Dialog miteinander erarbeiten die Teilnehmerstaaten Standards für demokratische, administrative, soziale und wirtschaftliche Verbesserungen und kontrollieren deren Umsetzung.
Der APRM wurde 2002 als Teil der Entwicklungsinitiative New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) ins Leben gerufen. Die Teilnahme ist freiwillig und steht allen Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union (AU) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) offen. Zum APRM gehört auch ein innerstaatlicher Dialogprozess, der alle wichtigen politischen und gesellschaftlichen Kräfte einbeziehen soll, unter anderen die Medien und zivilgesellschaftliche (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Gruppen.
Die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker wurde 1981 von der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) einstimmig verabschiedet und trat 1986 in Kraft. Die Charta wird auch als Banjul-Charta bezeichnet, weil sie in Banjul, der Hauptstadt von Gambia, erarbeitet wurde . Mit Ausnahme Marokkos haben alle Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) das Abkommen ratifiziert.
Die Charta orientiert sich an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen, will aber ausdrücklich auch afrikanische Traditionen und Werte widerspiegeln. Sie beinhaltet sowohl bürgerliche und politische als auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
Rechte und Pflichten
Anders als andere Menschenrechtsabkommen umfasst die Afrikanische Charta nicht nur die Rechte der einzelnen Person, sondern auch ihre Pflichten gegenüber der Familie, der Gesellschaft und der internationalen Gemeinschaft. Demnach ist zum Beispiel jeder Mensch verpflichtet, seine Mitmenschen zu respektieren und Toleranz zu fördern, für eine harmonische Familie zu sorgen, Steuern zum Wohl der Gemeinschaft zu zahlen und afrikanische kulturelle Werte aufrechtzuerhalten.
Die Charta enthält außerdem kollektive Rechte („Rechte der Völker“) wie das Recht auf Selbstbestimmung und Freiheit von fremder Herrschaft, das Recht auf Dekolonisierung sowie das Recht der Völker auf Frieden, Entwicklung und auf alleinige Verfügung über Bodenschätze.
Um die Einhaltung der Charta sicherzustellen, wurde der Afrikanische Gerichtshof für Menschenrechte und Rechte der Völker (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in Arusha, Tansania, eingerichtet.
Die Afrikanische Entwicklungsbank (African Development Bank, AfDB) ist eine regionale Entwicklungsfinanzierungsinstitution, die aus der Bank selbst (AfDB), dem Afrikanischen Entwicklungsfonds (ADF) und dem Nigeria Trust Fund (NTF) besteht. Sie wurde 1964 mit dem Ziel gegründet, Armut in Afrika zu bekämpfen und eine nachhaltige wirtschaftliche sowie soziale Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent zu fördern.
Die AfDB versteht sich auf globaler Ebene als die „Stimme Afrikas“ und zählt insgesamt 81 Mitgliedstaaten, darunter 54 regionale und 27 nicht-regionale Mitglieder. Die zentralen Förderbereiche werden in der Zehnjahresstrategie 2024 bis 2033 festgehalten und umfassen die Bereiche Energie, Landwirtschaft und Ernährungssicherung, Industrialisierung, regionale Integration sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität. Darüber hinaus legt die AfDB besonderen Wert auf Querschnittsthemen wie Klimawandel, fragile Staatlichkeit, Geschlechtergerechtigkeit und gute Regierungsführung. Der Hauptsitz der AfDB befindet sich in Abidjan, Côte d’Ivoire.
Deutschland, das der Bank 1983 beitrat, ist mit 4,1Prozent der Stimmrechtsanteile der größte europäische Anteilseigner der AfDB.
Ausführliche Informationen über die Afrikanische Entwicklungsbank finden Sie hier. (Externer Link)
Die Afrikanische Union (AU) ist der wichtigste regionale Zusammenschluss afrikanischer Staaten. Die AU wurde 2002 im südafrikanischen Durban in Nachfolge der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gegründet. Ihr Hauptziel ist die solidarische Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten, um Frieden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Wohlstand für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Kontinents zu erreichen.
Die Afrikanische Union engagiert sich besonders in regionalen Konflikten und führt eigene diplomatische und militärische Missionen durch. Weitere Handlungsfelder sind die Verbesserung von Regierungsführung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Institutionen, die Vertretung afrikanischer Interessen auf globaler Ebene, die Stärkung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die Förderung eines nachhaltigen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) wirtschaftlichen Wachstums und der Ausbau der regionalen Infrastruktur.
Die AU und die Europäische Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) arbeiten seit 2007 im Rahmen der Afrika-EU-Partnerschaft zusammen. Neben dem politischen Dialog sollen gemeinsame Entwicklungsprogramme die Zusammenarbeit zwischen Afrika und Europa vertiefen.
Ausführliche Informationen über die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit der Afrikanischen Union finden Sie hier.
Externe Links:
Der Afrikanische Entwicklungsfonds (African Development Fund, ADF) ist Teil der Bankengruppe Afrikanische Entwicklungsbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (African Development Bank, AfDB). Er gewährt den am wenigsten entwickelten Ländern (Least Developed Countries, LDC (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) in Afrika finanzielle Hilfen in Form von Zuschüssen und Krediten zu besonders günstigen Konditionen.
- Externer Link: Informationen zum ADF auf der Website der Afrikanischen Entwicklungsbank (englisch) (Externer Link)
Das könnte Sie auch interessieren:
Der Afrikanische Gerichtshof für Menschenrechte und Rechte der Völker (African Court on Human and Peoples’ Rights) ist die jüngste der regionalen Gerichtsinstitutionen, die die Einhaltung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) überwachen. Das Gremium nahm 2006 seine Arbeit auf und hat seinen Sitz in Arusha, Tansania.
Der Afrikanische Gerichtshof für Menschenrechte überwacht die Einhaltung der Menschenrechte im Sinne der Afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker (Banjul-Charta (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Er ist ein Organ der Afrikanischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Externer Link:
Am 25. September 2015 wurde auf einem UN-Gipfel in New York die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ verabschiedet. Sie hat die Form eines Weltzukunftsvertrags und enthält 17 Entwicklungsziele („Sustainable Development Goals“, SDGs). Die Agenda 2030 ist das erste internationale Abkommen, in dem das Prinzip der Nachhaltigkeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) mit der Armutsbekämpfung und der ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung verknüpft wird.
Die Agenda soll helfen, allen Menschen weltweit ein Leben in Würde zu ermöglichen. Sie soll Frieden fördern und sie soll dazu beitragen, dass alle Menschen in Freiheit und einer intakten Umwelt leben können.
Die Agenda richtet sich an alle Staaten der Weltgemeinschaft. Sie sind gleichermaßen aufgefordert, sich für die in ihr formulierten Entwicklungsziele einzusetzen – eine Einteilung in „Geber“ und „Nehmer“ oder in „erste“, „zweite“ und „dritte Welt“ gibt es in der Agenda nicht.
Ausführliche Informationen über die Agenda 2030 und ihre 17 Entwicklungsziele finden Sie hier.
Die Agenda 21 (Agenda = Tagesordnung) wurde 1992 bei der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in Rio de Janeiro verabschiedet und ist ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm mit konkreten Handlungsempfehlungen für das 21. Jahrhundert.
Sie fordert eine neue Entwicklungs- und Umweltpartnerschaft zwischen den Industriestaaten und den armen Ländern. Wichtige entwicklungspolitische Ziele wie Armutsbekämpfung und nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen Wasser (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Boden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Wald (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sind hier ebenso verankert wie umweltpolitische Ziele, etwa die Reduzierung des Treibhauseffekts. Die Agenda 21 betont, dass auch regierungsunabhängige Organisationen und Einrichtungen an politischen Entscheidungen zu beteiligen sind. Sie definiert Nachhaltigkeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) als übergreifendes Ziel der Politik.
- Externer Link: Text der Agenda 21 (PDF 3,3 MB) (Externer Link)
AGIAMONDO (bis 2019: AGEH – Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe) ist der Personaldienst der deutschen katholischen Kirche für internationale Zusammenarbeit. Der Fachdienst ist eine der sieben in Deutschland staatlich anerkannten Einrichtungen zur Entsendung von Fachkräften nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz (EhfG).
- Externer Link: Website von AGIAMONDO (Externer Link)
Subventionen der Industriestaaten für ihre eigene Landwirtschaft machen es den Menschen in den Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) schwer, ihre Erzeugnisse wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt abzusetzen. Die Preise der Industrieländer liegen durch die Subventionen häufig weit unter den Produktionskosten. Faire Chancen für Entwicklungsländer sind auf dem Weltmarkt nur erreichbar, wenn die Industrieländer ihre Agrarexportsubventionen abbauen und Handelshemmnisse für den Import von Waren aus Entwicklungsländern beseitigen. Für diese Ziele setzt sich die deutsche Bundesregierung mit ihrer internationalen Entwicklungs- und Handelspolitik ein.
Das könnte Sie auch interessieren:
Agrobiodiversität ist ein Bestandteil der biologischen Vielfalt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und umfasst die Vielfalt der landwirtschaftlich genutzten Pflanzen- und Tierarten sowie Ökosysteme. Sie dient sowohl der Anpassung der Landwirtschaft an globale Umweltveränderungen als auch der Ernährungssicherung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Agrobiodiversität leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Armutsminderung in den Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Die ursprünglich vorhandene Vielfalt von Nutzpflanzen und Nutztieren ist jedoch weltweit stark rückläufig. Grund hierfür ist in erster Linie die moderne Landwirtschaft selbst, die sich auf wenige ertragreiche Arten konzentriert. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit fördert deshalb den Erhalt der landwirtschaftlichen Vielfalt durch zahlreiche Maßnahmen im Bereich der ländlichen Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Ausführliche Informationen über das deutsche Engagement zum Schutz der Agrobiodiversität finden Sie hier.
Aid-Effectiveness-Agenda bezeichnet einen internationalen politischen Prozess mit dem Ziel, die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit zu erhöhen. Zwischen 2003 und 2011 fanden vier hochrangige Foren zu diesem Thema statt. Zum Abschluss jeder Konferenz formulierten Industrie-, Schwellen- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Entwicklungsländer gemeinsame Prinzipien für eine verbesserte Zusammenarbeit:
Mit dem englischen Begriff „Aid for Trade“ werden handelsbezogene entwicklungspolitische Maßnahmen beschrieben. Mit diesen unterstützt Deutschland seine Partnerländer dabei, ihren Handel zu liberalisieren und zugleich notwendige begleitende Reformschritte einzuleiten. Denn der Außenhandel ist zwar ein wichtiger Baustein für anhaltendes Wachstum und hat großes Potenzial, maßgeblich zu nachhaltiger Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) beizutragen. Allerdings führt eine Handelsliberalisierung nicht automatisch zu mehr Handel, Armutsreduzierung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Entwicklung. Oft fehlt den Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) das Wissen, die Infrastruktur und die finanzielle und personelle Ausstattung, um Handelschancen positiv nutzen und Risiken minimieren zu können.
Hier unterstützt das BMZ seine Partnerländer durch Aid for Trade: Die Regierungen werden beraten, wie sie ihre politischen Strategien und Verhandlungspositionen formulieren und Abkommen wirksam umsetzen können. Der Privatsektor und die Landwirtschaft werden dabei unterstützt, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, ihr Angebot auszuweiten und ihre Exportchancen zu erhöhen. Gefördert werden zum Beispiel die Steigerung von Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit, die Einführung neuer Produkte, der effiziente Einsatz von Ressourcen und die Einhaltung von Qualitäts-, Sozial- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Umweltstandards (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Das Kurzwort Aids steht für „Acquired Immune Deficiency Syndrome“ und bedeutet „erworbenes Immunschwäche-Syndrom“. Die Krankheit wird durch das HI-Virus (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) hervorgerufen (menschliches Immunschwäche-Virus, englisch: Human Immunodeficiency Virus, HIV), der das Immunsystem des Infizierten zerstört. Die Krankheit hat sich auf der gesamten Welt verbreitet. Bislang gibt es für sie kein Heilmittel, sondern nur eine Behandlung, die den Krankheitsverlauf zum Stillstand bringen kann. Nach Angaben des Aids-Programms der Vereinten Nationen (UNAIDS (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) leben derzeit etwa 38 Millionen Menschen mit dem HI-Virus, davon etwa zwei Drittel in den Staaten Afrikas südlich der Sahara. Trotz vielfältiger nationaler und internationaler Anstrengungen und erreichter Erfolge bleibt HIV ein wesentliches Entwicklungshemmnis. Denn in den Ländern mit hoher HIV-Rate werden wirtschaftliche und soziale Fortschritte durch die Epidemie deutlich erschwert.
Die internationale Gemeinschaft verfolgt das Ziel, möglichst allen Menschen weltweit, die von HIV betroffen sind, Zugang zu Prävention, Behandlung, Versorgung und Pflege zu verschaffen. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt Partnerländer bei der Umsetzung von entsprechenden Programmen und stellt dafür umfangreiche Finanzmittel zur Verfügung.
Ausführliche Informationen zum Thema HIV und Aids in der Entwicklungszusammenarbeit finden Sie hier.
- Externer Link: Website von UNAIDS (englisch) (Externer Link)
Der AKLHÜ (früher: Arbeitskreis „Lernen und Helfen in Übersee“) bezeichnet sich heute als „Netzwerk und Fachstelle für internationale Personelle Zusammenarbeit“. Er vertritt die Interessen von Freiwilligen- und Fachdiensten und wirbt für ihre Förderung durch Politik, staatliche Organisationen, Stiftungen und andere Akteure. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Kooperation und Vernetzung seiner Mitglieder, die Forschung zu Freiwilligen- und Fachdiensten, die politische Interessenvertretung für die internationale personelle Zusammenarbeit und die Stärkung und Weiterentwicklung internationaler Dienste.
- Externer Link: Website des AKLHÜ (Externer Link)
Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten. Derzeit gehören diesem Zusammenschluss 79 Staaten an. Sie sind mit der Europäischen Union durch das Samoa-Abkommen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) partnerschaftlich verbunden.
Bei der dritten internationalen Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung 2015 in Addis Abeba (Äthiopien) verabschiedeten die Vereinten Nationen die Aktionsagenda von Addis Abeba (Externer Link). Sie bietet einen globalen Rahmen für die nachhaltige Finanzierung der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).
Die globale Staatengemeinschaft hat sich mit der Aktionsagenda das Ziel gesetzt, Finanzierungsströme und strukturelle politische Maßnahmen an den Nachhaltigkeitszielen der der Agenda 2030 und damit an der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung auszurichten.
Die Aktionsagenda von Addis Abeba enthält Verpflichtungen und Handlungsanweisungen für sieben Aktionsbereiche:
- Inländische öffentliche Mittel
- Inländische und internationale Privatwirtschaft und Finanzen
- Internationale Entwicklungszusammenarbeit
- Internationaler Handel als Motor für Entwicklung
- Verschuldung und Schuldentragfähigkeit
- Behandlung von systemischen Fragen (unter anderem zum Finanz-, Währungs- und Handelssystem)
- Wissenschaft, Technologie, Innovation und Kapazitätsaufbau
Das dritte hochrangige Forum zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit fand 2008 in Accra (Ghana) statt. Dort wurden die auf den vorangegangenen Foren in Rom (2003) und Paris (2005) vereinbarten Prinzipien bekräftigt und bei der Umsetzung aufgetretene Hindernisse analysiert.
Das Abschlussdokument des Forums, der Aktionsplan von Accra („Accra Agenda for Action“), stellt die Effektivität von Entwicklungsleistungen in einen breiteren entwicklungspolitischen Zusammenhang. So sind die Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die Gleichstellung der Geschlechter, der Umweltschutz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie Aspekte guter Regierungsführung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) als zentrale Faktoren wirksamer Entwicklungszusammenarbeit im Aktionsplan verankert. Transparenz und Rechenschaftspflicht sollen durch eine breitere Beteiligung von Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Parlamenten verbessert werden.
Externer Link:
Siehe auch:
Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung fördert die internationale Forschungskooperation. Sie ermöglicht hoch qualifizierten ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Forschungsaufenthalte in Deutschland. Darüber hinaus vergibt sie Forschungsstipendien an Deutsche für Aufenthalte im Ausland.
Im Bereich Entwicklungspolitik bietet die Humboldt-Stiftung jährlich bis zu 60 Forschungsstipendien für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Kooperationsländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit an. Diese können sich über einen Zeitraum von sechs bis 24 Monaten an einer deutschen Forschungseinrichtung einem wissenschaftlichen Vorhaben widmen, das für ihr Herkunftsland eine besondere entwicklungspolitische Bedeutung hat.
- Externer Link: Website der Alexander-von-Humboldt-Stiftung (Externer Link)
Am 10. Dezember 1948 verkündete die Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). In 30 Artikeln formuliert sie bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Viele der seit 1948 geschlossenen Übereinkommen, Gesetze und Verträge basieren auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, etwa regionale Menschenrechtsabkommen wie die Europäische Menschenrechtskonvention (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Als Erklärung der UN-Generalversammlung hat sie zwar nicht die rechtsverbindliche Kraft eines Vertrages, der von Einzelstaaten ratifiziert werden kann, doch sie hat politisch und moralisch ein sehr großes Gewicht. Ihre Bestimmungen sind in viele nationale Verfassungen aufgenommen worden und es ist inzwischen anerkannt, dass einige ihrer Bestimmungen bindendes Völkergewohnheitsrecht und teilweise sogar zwingendes Völkerrecht sind. Zwingendes Völkerrecht bedeutet, dass kein Staat davon abweichen darf. Das betrifft zum Beispiel die Verbote der Sklaverei, der Folter und der rassistischen Diskriminierung.
Internationale Menschenrechtscharta
Um den Menschenrechten, die in der Allgemeinen Erklärung enthalten sind, eine völkerrechtlich verbindliche Form zu geben, verabschiedeten die Vereinten Nationen 1966 zwei Menschenrechtspakte: den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Beide traten 1976 in Kraft. Zusammen mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den zwei Zusatzprotokollen zum Zivilpakt bilden sie die so genannte internationale Menschenrechtscharta (International Bill of Human Rights), ein Begriff, der vor allem im englischsprachigen Raum gebräuchlich ist.
- Externer Link: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Externer Link)
Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) trat 1948 in Kraft und bestimmte annähernd 50 Jahre lang die Regeln des internationalen Handels. Ziel des multilateralen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Abkommens war die Förderung der weltwirtschaftlichen Entwicklung und des Wohlstands durch den Abbau von Handelshemmnissen (etwa Zöllen und Subventionen) und die Schlichtung von Handelskonflikten.
Das GATT-Sekretariat wurde 1995 durch die neu gegründete Welthandelsorganisation (WTO) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) abgelöst. Das Abkommen bleibt jedoch ein wichtiges Vertragswerk für den internationalen Handel und wird innerhalb der WTO weiterentwickelt.
Die Alliance on Transformative Action on Climate and Health (ATACH) setzt sich dafür ein, klimaresistente und nachhaltige (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)Gesundheitssysteme aufzubauen und den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit in nationale, regionale und globale Strategien und Planungsprozesse einzubeziehen. Sie dient der Interessenvertretung und dem Wissensaustausch, leistet technische Unterstützung und fördert den Zugang zu Finanzierung.
Die Allianz ging aus der 26. UN-Klimakonferenz (COP26) im November 2021 hervor, die erstmals ein Gesundheitsprogramm enthielt. Das ATACH-Sekretariat ist bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) angesiedelt.
Inzwischen sind der Allianz mehr als 80 Staaten beigetreten (Stand: Oktober 2024). Sie steht außerdem zwischenstaatlichen Organisationen, Wirtschaftsverbänden sowie Nichtregierungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), zivilgesellschaftlichen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Gruppen und philanthropischen Stiftungen offen.
- Externer Link: Website von ATACH (Externer Link) (englisch)
Das Alumniportal Deutschland ist ein kostenloses soziales Netzwerk für Menschen aus aller Welt, die in Deutschland studiert, geforscht, gearbeitet oder sich weitergebildet haben. Herzstück des Portals ist eine Online-Community, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Kontakte aufbauen und für ihre persönliche und berufliche Entwicklung nutzen können. Außerdem bietet das Portal Informationen über Veranstaltungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Stellenangebote in aller Welt. Das Portal wird von der Bundesregierung finanziert.
- Externer Link: Website des Alumniportals Deutschland (Externer Link)
Die Amerikanische Menschenrechtskonvention der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) wurde 1969 als regionaler, multilateraler Vertrag zum Schutz der Menschenrechte verabschiedet. Die Konvention trat 1978 in Kraft. 24 mittel- und südamerikanische Staaten haben sie bislang ratifiziert (Stand: September 2024).
Die Konvention enthält bürgerliche und politische Rechte, darunter das Recht auf Leben und eine humane Behandlung, das Recht auf einen Namen und eine Nationalität, das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf rechtlichen Schutz und ein faires Verfahren.
Um die Einhaltung der Konvention sicherzustellen, wurde der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in San José, Costa Rica, eingerichtet. An ihn können sich Personen wenden, um die in der Konvention festgeschriebenen Rechte gegenüber den Mitgliedsstaaten einzuklagen.
Das Zusatzprotokoll von San Salvador
Um auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte auf interamerikanischer Ebene zu verankern, wurde 1988 das Zusatzprotokoll von San Salvador verabschiedet, das 1999 in Kraft trat. Es wurde bisher von 18 mittel- und südamerikanischen Staaten ratifiziert (Stand: September 2024). Das Zusatzprotokoll orientiert sich am UN-Sozialpakt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und enthält unter anderen die Rechte auf Bildung und auf Arbeit. Stellenweise geht das Zusatzprotokoll im Umfang über den UN-Sozialpakt hinaus.
Eine achtköpfige Arbeitsgruppe überwacht die Einhaltung des Protokolls und begutachtet die regelmäßigen Berichte der Mitgliedsstaaten.
Externe Links:
Die Andengemeinschaft (Comunidad Andina de Naciones, CAN) ist ein Zusammenschluss der vier südamerikanischen Staaten Bolivien, Ecuador, Kolumbien und Peru. Sie löste 1997 die Zusammenarbeit im Rahmen des Andenpakts (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ab. Ziele der Andengemeinschaft sind unter anderem eine intensive regionale Zusammenarbeit auf politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Ebene, die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung, der schrittweise Aufbau eines gemeinsamen Marktes und die bessere Positionierung der Region auf dem Weltmarkt.
- Externer Link: Website der Andengemeinschaft (spanisch) (Externer Link)
1969 vereinbarten die südamerikanischen Staaten Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien und Peru im Übereinkommen von Cartagena eine regelmäßige regionale Zusammenarbeit. Das Abkommen und die anschließende politische Zusammenarbeit wurden in der Folge als Andenpakt (Pacto Andino) bezeichnet. Der Andenpakt ging 1997 über in die Andengemeinschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Comunidad Andina de Naciones, CAN).
Die Arabische Charta der Menschenrechte wurde 2004 von den Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga beschlossen und trat 2008 in Kraft. Sie beruft sich auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen und sichert jedem Individuum grundlegende bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zu. Dazu zählen die Rechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf Meinungsäußerungs- und Versammlungsfreiheit sowie die Rechte auf Arbeit, soziale Sicherung, eine saubere Umwelt und Entwicklung.
Die Umsetzung der Charta wird von einem Expertenausschuss kontrolliert, dem die Staaten regelmäßig Bericht erstatten. Ein Gerichtshof, an den sich Personen wenden können, um die in der Charta festgeschriebenen Rechte gegenüber den Mitgliedsstaaten einzuklagen, existiert bislang nicht.
- Externer Link: Arabische Charta der Menschenrechte (Externer Link)
Die Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungsdienste (AGdD) wurde 1993 als Dachverband der sieben Entwicklungsdienste in Deutschland gegründet. Mitglieder der AGdD sind AGIAMONDO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (bis 2019: AGEH), die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), Dienste in Übersee, Coworkers – Christliche Fachkräfte International (CFI), EIRENE, Weltfriedensdienst und das Forum Ziviler Friedensdienst (forum ZFD).
Die sieben Organisationen sind vom BMZ als „Träger des Entwicklungsdienstes“ anerkannt und unterstützen die deutsche Entwicklungszusammenarbeit durch die Entsendung von berufserfahrenen Fachkräften. Rechtliche Grundlage ihrer Arbeit ist das Entwicklungshelfer-Gesetz (EhfG) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Zur AGdD gehört auch das Förderungswerk für rückkehrende Fachkräfte der Entwicklungsdienste. Es unterstützt Entwicklungshelferinnen und -helfer bei der beruflichen Wiedereingliederung in Deutschland.
Externe Links:
Ziel 1 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) lautet, Armut in jeder Form und überall zu beenden.
Der Entwicklungsausschuss der OECD (DAC) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) versteht unter Armut die Unfähigkeit, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen. Zu diesen Bedürfnissen gehören vor allem der Konsum und die Sicherheit von Nahrungsmitteln (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Gesundheitsversorgung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Ausübung von Rechten, Mitsprache (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Sicherheit und Würde sowie menschenwürdige Arbeit.
Als absolute Armut ist dabei ein Zustand definiert, in dem sich ein Mensch die Befriedigung seiner wirtschaftlichen und sozialen Grundbedürfnisse nicht leisten kann. Relative Armut beschreibt Armut im Verhältnis zum jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld eines Menschen.
Armut ist ein dynamischer Prozess und keine Eigenschaft. In der Regel sind es einschneidende familiäre Ereignisse (zum Beispiel Krankheitsfälle, Todesfälle, das Aufbringen einer Mitgift für eine Hochzeit) oder größere Krisen (wie bewaffnete Konflikte, Naturkatastrophen, Wirtschaftsflauten), die Menschen in Armut stürzen.
Vielen Menschen gelingt es, ihre Lebensumstände aus eigener Kraft so zu verbessern, dass sie sich aus der Armut befreien können. Lediglich ein Viertel bis ein Drittel der von Armut betroffenen Menschen sind Schätzungen zufolge chronisch – also Zeit ihres Lebens – arm.
Die Reduzierung der Armut ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart. Der Einsatz gegen Armut und für weltweit bessere Lebensbedingungen ist eine der wichtigsten Aufgaben der internationalen und auch der deutschen Politik.
Armut messen
Armut zu messen ist schwierig, jeder empfindet sie anders. Hunger (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Krankheiten oder Angst sind schwer messbar. Darum gibt es international akzeptierte Kriterien, die dabei helfen zu erfassen, was Armut ist und wer als arm gilt.
Bei der Messung von Armut haben sich verschiedene Ansätze durchgesetzt. Nach der Definition der Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sind Menschen extrem arm, wenn sie weniger als 3,00 US-Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Bei diesem Ansatz wird die Kaufkraft des US-Dollars in lokale Kaufkraft umgerechnet. Das heißt, dass extrem arme Menschen nicht in der Lage sind, sich täglich die Menge an Gütern zu kaufen, die in den USA 3,00 US-Dollar kosten würden. Die 3,00-Dollar-Grenze wird als finanzielles Minimum angesehen, das eine Person zum Überleben braucht. Demnach lebten im Jahr 2022 nach Schätzungen bis zu 750 Millionen Menschen in extremer Armut. Durch die Umrechnung in lokale Kaufkraft können die Armutsquoten international verglichen werden.
Zunehmend gibt es Versuche, auch andere Dimensionen von Armut statistisch abzubilden. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) berechnet zum Beispiel den mehrdimensionalen Armutsindex (Multidimensional Poverty Index, MPI). Er misst, wie stark ein Haushalt unter Entbehrungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Lebensstandard leidet. Auch der Index der menschlichen Entwicklung (HDI) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) versucht, mehrere Dimensionen entlang einer Skala von 0 bis 1 abzubilden, beschreibt dabei jedoch nicht den Zustand einzelner Haushalte, sondern den Entwicklungsstand eines Landes. Indikatoren für den HDI sind unter anderem die Lebenserwartung bei der Geburt, die Alphabetisierungsrate, das Bildungsniveau und die reale Kaufkraft pro Kopf in einem Land.
Das ASA-Programm unter dem Dach der gemeinnützigen Gesellschaft Engagement Global (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist ein entwicklungspolitisches Lern- und Qualifizierungsprogramm. Es entstand 1960 aus einer Initiative von Studentinnen und Studenten – damals unter dem Namen Programm für Arbeits- und Studienaufenthalte. Es umfasst Trainingsseminare und drei- oder sechsmonatige Praxisaufenthalte in Afrika, Lateinamerika, Asien oder Südosteuropa. Das Programm richtet sich an Menschen zwischen 21 und 30 Jahren, die studieren oder eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Ein aktives Netzwerk ermöglicht den Austausch von Wissen und Erfahrungen und fördert das Engagement in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit.
Im Jahr 2012 verabschiedeten die Mitgliedsstaaten der Vereinigung südostasiatischer Länder (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) eine gemeinsame Menschenrechtserklärung. Sie ist rechtlich unverbindlich. Es gibt keine Institutionen, die die Umsetzung kontrollieren oder an die sich Personen wenden können, um die in der Erklärung festgeschriebenen Rechte einzuklagen. Eine Kommission der ASEAN-Mitgliedsstaaten (Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR), unterstützt unter anderem bei der Ausarbeitung von Menschenrechtsverträgen.
Die Erklärung beinhaltet mehrere Menschenrechte, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verankert sind. Darüber hinaus beinhaltet sie ausdrücklich die Rechte auf Wasser und Sanitärversorgung sowie die Rechte auf Solidarität, Entwicklung, eine saubere Umwelt und Frieden.
- Externer Link: ASEAN-Menschenrechtsdeklaration (englisch) (Externer Link)
Die Asiatische Entwicklungsbank (Asian Development Bank, ADB) ist eine regionale Institution zur Entwicklungsfinanzierung, die 1966 mit Deutschland als Gründungsmitglied ins Leben gerufen wurde, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Kooperation in einer der damals ärmsten Regionen der Welt zu fördern. Mit insgesamt 69 Mitgliedsstaaten – darunter 50 aus Asien und dem Pazifikraum sowie 19 aus Europa und Nordamerika – zählt die ADB zu den größten multilateralen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen im asiatisch-pazifischen Raum. Ihr Hauptsitz befindet sich in Manila auf den Philippinen.
Die ADB stellt finanzielle Mittel für soziale und wirtschaftliche Projekte bereit, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen der Menschen in Asien und im Pazifikraum nachhaltig zu verbessern. Ihre strategischen Schwerpunkte sind in der „Strategy 2030“ verankert und umfassen unter anderem die Themen Klimaschutz, Entwicklung des Privatsektors, regionale Zusammenarbeit und öffentliche Güter, digitale Transformation sowie Resilienz und Empowerment.
Deutschland als größter europäischer Anteilseigner (3,7 Prozent der Stimmrechtsanteile) trägt maßgeblich zur Gestaltung der Agenda der ADB bei.
Ausführliche Informationen über die Asiatische Entwicklungsbank finden Sie hier (Externer Link).
Der Asiatische Entwicklungsfonds (Asian Development Fund, ADF) ist ein Finanzierungsinstrument der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Aus dem ADF erhalten ärmere regionale ADB-Mitglieder zinsgünstige Kredite und Zuschüsse.
- Externer Link: Informationen zum ADF auf der Website der Asiatischen Entwicklungsbank (englisch) (Externer Link)
Das könnte Sie auch interessieren:
Menschen, die in ein anderes Land eingereist sind und einen Antrag auf ihre Anerkennung als Flüchtlinge (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gestellt haben, werden als Asylsuchende bezeichnet.
Solange über ihren Asylantrag noch nicht entschieden wurde, sind sie noch keine offiziell anerkannten Flüchtlinge. Sie stehen aber unter dem Schutz der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Externer Link), die in Artikel 14.1 besagt: „Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen“. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat jedoch keinen völkerrechtlich bindenden Status – die dort definierten Rechte können nicht unter Berufung auf die Erklärung eingeklagt werden.
Der Ausschuss für Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und humanitäre Hilfe ist ein Gremium des Deutschen Bundestags. Er gehört zu den ständigen Ausschüssen, die der Bundestag in seiner aktuellen Wahlperiode eingesetzt hat. In Ausschüssen konzentrieren sich die Abgeordneten jeweils auf ein Teilgebiet der Politik und bereiten Bundestagsentscheidungen fachlich vor.
Die zentralen Aufgaben des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sind die Überprüfung der Menschenrechtspolitik der Bundesregierung im In- und Ausland sowie die Beratung von parlamentarischen Initiativen mit Menschenrechtsbezug. Auch die humanitären Folgen von Naturkatastrophen und Kriegen werden im Ausschuss diskutiert, um die deutsche Beteiligung an Hilfsmaßnahmen besser beurteilen zu können. Der Ausschuss behandelt vorwiegend Menschenrechtsfragen in Schwellen- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (AwZ) ist ein Gremium des Deutschen Bundestages. Er gehört zu den ständigen Ausschüssen, die der Bundestag in der aktuellen Wahlperiode eingesetzt hat und befasst sich mit Fragen der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Der AwZ hat unter anderem die Aufgabe, Verhandlungen und Entscheidungen des Parlaments vorzubereiten und zu vertiefen. Dazu führt er auch öffentliche Anhörungen durch.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Außenrevision des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) prüft, ob die Fördermittel des BMZ von den Empfängerorganisationen wirtschaftlich, effektiv und zweckentsprechend verwendet werden. Dazu werden die Geschäfts- und Buchungsunterlagen der Organisationen kontrolliert. Die Überprüfungen finden sowohl in Deutschland als auch in den Kooperationsländern statt. Nicht zweckentsprechend verwendete Gelder müssen mit Zinsen zurückgezahlt werden.
Ausführliche Informationen über das Thema Außenrevision finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
AWO International koordiniert die internationalen Aktivitäten der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die Arbeit basiert auf den in der Arbeiterbewegung verankerten Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität. Themenschwerpunkte sind Kinder- und Jugendrechte, Klimawandel und Ernährungssicherheit, Migration und Menschenhandel, Geschlechtergerechtigkeit, Katastrophenvorsorge und humanitäre Nothilfe.
AWO International wird vom BMZ gefördert und engagiert sich in Mittelamerika, Afrika, im Nahen Osten sowie in Süd- und Südostasien.
- Externer Link: Website von AWO International (Externer Link)
Das könnte Sie auch interessieren:
Im November 1995 wurde auf einer Außenministerkonferenz in Barcelona die Euro-Mediterrane Partnerschaft ins Leben gerufen. Ziel der Partnerschaft war, zwischen den damals 15 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und zwölf Anrainerstaaten des Mittelmeerraumes eine Zone des Friedens, der Demokratie, der Stabilität, der Zusammenarbeit und des Wohlstands zu schaffen. Diese Partnerschaft wird auch Barcelona-Prozess genannt. Sie wurde 2008 zur Union für den Mittelmeerraum (UfM) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) erweitert.
Das Programm „Beigeordnete Sachverständige“ (englisch: Junior Professional Officers, JPO) bietet deutschen Nachwuchskräften die Möglichkeit, internationale Berufserfahrung zu sammeln und so ihre Chancen auf eine Beschäftigung bei einer internationalen Organisation deutlich zu erhöhen. Sie sind für einen befristeten Zeitraum (in der Regel 24 Monate) bei den Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) mit ihren verschiedenen Unter- und Sonderorganisationen, der Weltbankgruppe (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) oder anderen Finanzinstitutionen im Einsatz. Deutschland hat mit etwa 30 internationalen Organisationen Abkommen zur Entsendung von Beigeordneten Sachverständigen geschlossen.
Innerhalb der Bundesregierung ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) federführend für das JPO-Programm verantwortlich.
Unter dem Dach der Servicegesellschaft Engagement Global (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) berät und fördert die Beratungsstelle für private Träger in der Entwicklungszusammenarbeit (bengo) im Auftrag des BMZ deutsche Nichtregierungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (NROs), Gruppen und Initiativen, die gemeinsam mit Partner-NROs in Entwicklungsländern Projekte (ab einem Fördervolumen von 50.000 Euro) entwickeln. Die Beratung umfasst alle Projektphasen – von der Prüfung der Fördervoraussetzungen über die Antragstellung bis zur Projektdurchführung und Finanzabwicklung.
Seit dem 1. Januar 2019 ist bengo allerdings nicht mehr für die Beratung von Erstantragstellern (maximale Fördersumme 50.000 Euro) zuständig. Diese Aufgabe hat das Bundesentwicklungsministerium (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der W.P. Schmitz-Stiftung und der Stiftung Nord-Süd-Brücken übertragen.
Seit 1990 veröffentlicht das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (United Nations Development Programme, UNDP) jährlich einen Bericht über die menschliche Entwicklung (Human Development Report, HDR). Ein unabhängiges Expertenteam untersucht dafür entwicklungspolitische Fragen von globaler Bedeutung.
Zentraler Bestandteil des Berichts ist der Index der menschlichen Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (HDI), eine Rangliste, die den unterschiedlichen Entwicklungsstand der Länder der Welt aufzeigt.
Ergänzend zum globalen HDR erscheinen regionale, nationale und lokale Berichte sowie Sonderpublikationen zu verschiedenen Aspekten menschlicher Entwicklung.
Das Berufsfeld Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bietet im In- und Ausland vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Ein Engagement in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist unter anderem als Entwicklungshelferin, Fachkraft oder Gutachter möglich. Hinzu kommen Angebote für befristete Arbeits- oder Studienaufenthalte und Programme der entwicklungspolitischen Nachwuchsförderung. Die Bandbreite der Berufe ist sehr groß, sie reicht von Ärztinnen und Pflegern über Handwerkerinnen und Ingenieure bis hin zu Juristinnen und Pädagogen. Auch in Deutschland bietet die Entwicklungszusammenarbeit viele berufliche Chancen, unter anderem für Bürofachkräfte und Sachbearbeiter, Betriebswirtinnen und Wissenschaftler, Journalisten und Mediengestalterinnen.
Als Arbeitgeber kommen zahlreiche nationale und internationale Organisationen in Frage. Dazu zählen staatliche Institutionen wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und die Durchführungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie multilaterale Organisationen wie die Europäische Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und die Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Wichtige Akteure der Entwicklungszusammenarbeit sind außerdem die international tätigen Nichtregierungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Ausführliche Informationen über Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten beim BMZ finden Sie hier.
Für die deutsche Bundesregierung ist die berufliche Bildung ein Schlüsselbereich ihres entwicklungspolitischen Engagements. Die Förderung zielt in erster Linie darauf ab, praxisorientierte und an den Bedarf der Wirtschaft angepasste Berufsbildungssysteme zu entwickeln.
Die Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) stützt sich dabei auf die erfolgreichen Merkmale der dualen Berufsausbildung in Deutschland, die je nach Partnerland bedarfsgerecht angepasst werden: enge Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft, Lernen im Arbeitsprozess, gesellschaftliche Akzeptanz allgemeinverbindlicher Standards, Qualifizierung von Berufsbildungspersonal und begleitende Berufsbildungsforschung.
Die Vermittlung hochwertiger und nachfrageorientierter beruflicher Bildung folgt dem entwicklungspolitischen Ziel, die Chancen auf Beschäftigung und Einkommen für eine große Anzahl von Menschen in den Partnerländern zu erhöhen.
Ausführliche Informationen über das deutsche Engagement im Bereich der beruflichen Bildung finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Stichwort: Grundbildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Stichwort: Hochschulbildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Jeder Mensch hat das Recht auf uneingeschränktes körperliches und seelisches Wohlbefinden in allen Bereichen der Sexualität und Fortpflanzung. Staatliche Maßnahmen, die die Größe, das Wachstum und die räumliche Verteilung der Einwohnerschaft beeinflussen, bedeuten einen Eingriff in die intimsten Bereiche des menschlichen Lebens.
Andererseits hängen viele Entwicklungsprobleme wie Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Ressourcenknappheit oder Konflikte eng mit dem Bevölkerungswachstum (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zusammen. Eine ethisch legitimierte Bevölkerungspolitik muss daher sowohl die individuellen Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) schützen als auch eine nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) fördern. Sie darf nicht nur die Verminderung der Geburtenraten zum Ziel haben, sondern muss die Verbesserung der Lebensqualität anstreben.
Das könnte Sie auch interessieren:
Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (United Nations Population Fund, UNFPA) beschäftigt sich mit Fragen der reproduktiven Gesundheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der Bevölkerungsentwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in den Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Seine Aufgabe ist es, weltweit das Bewusstsein für diese Themen zu fördern. Der UNFPA unterstützt Programme, die insbesondere jungen Menschen bei der Familienplanung helfen und ungewollte Schwangerschaften verhindern. Er setzt sich für eine qualifizierte Betreuung von Schwangerschaften und Geburten ein und hilft, durch Aufklärungsarbeit die Verbreitung von HIV (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)/Aids (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten einzudämmen. Außerdem setzt sich der Bevölkerungsfonds für Chancengleichheit ein und bekämpft Gewalt gegen Frauen.
Der UNFPA veröffentlich jährlich den Weltbevölkerungsbericht. Dieser erläutert aktuelle Themen der Bevölkerungsentwicklung und enthält demografische und sozioökonomische Daten für alle Länder und Regionen der Erde.
Weitere Informationen über die Zusammenarbeit des BMZ mit dem UNFPA finden Sie hier.
- Externer Link: Website des UNFPA (englisch) (Externer Link)
Innerhalb der vergangenen hundert Jahre ist die Weltbevölkerung rasant gewachsen. Im Jahr 1800 lebten eine Milliarde Menschen auf der Welt und es brauchte mehr als 100 Jahre – bis 1927 – bis die zweite Milliarde erreicht war. Seit 1950 (2,5 Milliarden Menschen) geht die Wachstumskurve steil nach oben: 1987 wurde bereits die Fünf-Milliarden-Marke überschritten, 2011 die Sieben-Milliarden-Marke und seit Ende 2022 leben mehr als acht Milliarden Menschen auf der Erde.
Nach Schätzungen der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) wird sich das Bevölkerungswachstum fortsetzen, jedoch verlangsamen: Bis zum Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung demnach auf 9,7 Milliarden Menschen ansteigen. In den 2080er Jahren soll der Höchststand von 10,4 Milliarden Menschen erreicht werden und sich bis zum Jahr 2100 auf diesem Niveau einpendeln.
Das Bevölkerungswachstum ist jedoch regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es findet fast ausschließlich in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) statt. So wird sich die Bevölkerung in vielen afrikanischen Ländern innerhalb der nächsten Jahrzehnte höchstwahrscheinlich verdoppeln.
Die Folgen dieses Wachstums sind nicht eindeutig abzuschätzen, aber viele Entwicklungsprobleme wie Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), fehlende Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), mangelnde Gesundheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), gewalttätige Konflikte oder die Zerstörung der Umwelt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sind eng mit dem Anstieg der Bevölkerung verbunden.
Damit alle Menschen selbstbestimmt und würdevoll leben können und eine nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) möglich wird, muss das Wachstum der Weltbevölkerung abgeschwächt werden. Die Verwirklichung sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist dafür eine entscheidende Voraussetzung. Dabei müssen vor allem die Rechte von Frauen und Mädchen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gestärkt und ihre Bildungschancen verbessert werden, damit sie gleichberechtigt über Schwangerschaft, Familien- und Lebensplanung mitentscheiden können.
Das könnte Sie auch interessieren:
Bilaterale Zusammenarbeit (von lateinisch „beidseitig“) ist die direkte, vertraglich vereinbarte Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zwischen Deutschland und einem Partnerland – etwa, wenn die Bundesrepublik einem sogenannten Entwicklungsland (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) einen günstigen Kredit vermittelt oder wenn deutsche Expertinnen und Experten kleinbäuerliche Betriebe in Afrika beraten. Diese Form der Zusammenarbeit beruht im Wesentlichen auf zwei Instrumenten: der finanziellen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der technischen Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Neben der staatlichen Kooperation umfasst die bilaterale Zusammenarbeit außerdem die nicht staatliche Zusammenarbeit, bei der die Bundesregierung die entwicklungspolitische Arbeit von privaten Organisationen finanziell fördert.
Ausführliche Informationen zur bilateralen Zusammenarbeit des BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) finden Sie hier.
Das BMZ verfolgt mit 39 ausgewählten bilateralen Partnerländern langfristig gemeinsame Entwicklungsziele:
Ägypten, Äthiopien, Algerien, Bangladesch, Benin, Bolivien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ecuador, Ghana, Jordanien, Kambodscha , Kamerun, Kenia, Kolumbien, Laos, Libanon, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Palästinensische Gebiete, Ruanda, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Tansania, Togo, Tunesien, Uganda, Usbekistan.
Bildung ist ein Menschenrecht. Auf der Basis von Bildung entwickelt sich die kulturelle Identität des Einzelnen und der Gesellschaft. Sie ist eine Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die Verringerung der weltweiten Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und für ein friedliches Zusammenleben. Bildung befähigt Menschen, ihre politische, soziale, kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation zu verbessern.
„Bildung für alle (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)“ ist daher das Ziel der internationalen und auch der deutschen Entwicklungspolitik. Das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) engagiert sich in seinen Partnerländern sowohl im Bereich der Grundbildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) als auch im Bereich der beruflichen Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der Hochschulbildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Ausführliche Informationen über das deutsche Engagement im Bereich Bildung finden Sie hier.
Im März 1990 veranstaltete die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) die erste Weltkonferenz zum Thema „Bildung für alle“. Die Teilnehmer verabschiedeten dabei die Weltdeklaration „Bildung für alle“ (Education for All, EFA), zu deren Zielen unter anderem der allgemeine Zugang zur Primarschulbildung, die qualitative Verbesserung der Grundbildung und die Senkung der Analphabetenrate bei Erwachsenen gehörten.
Die Erkenntnisse und Ziele der Weltkonferenz „Bildung für alle“ wurden auf zwei Weltbildungsforen in den Jahren 2000 und 2015 bestätigt und konkretisiert. Auch in die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) wurde die Bildung aufgenommen. Ziel 4 lautet: „Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern“.
Ausführliche Informationen über das deutsche Engagement im Bereich Bildung finden Sie hier.
Das Bildungswerk wurde 1974 als gemeinnützige Weiterbildungsorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gegründet. Seine Aufgabe ist die allgemeine, politische und gewerkschaftliche Wissensvermittlung. Arbeitsschwerpunkte sind die Stärkung der Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, der Einsatz für Menschen- und Gewerkschaftsrechte und die Durchsetzung von sozialen Mindeststandards (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Kernarbeitsnormen. In Zusammenarbeit mit Gewerkschaften sowie europäischen und internationalen Projektpartnern führt das Bildungswerk Entwicklungs- und Beratungsprojekte durch.
- Externer Link: Website des DGB-Bildungswerks (Externer Link)
Das könnte Sie auch interessieren:
Voraussetzung für den Flüchtlingsstatus ist, dass die jeweilige Person eine international anerkannte Grenze überschritten hat. Menschen, die in anderen Landesteilen ihres Herkunftsstaates Zuflucht finden, fallen daher nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention und das UNHCR (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Mandat. Für den Schutz von Binnenvertriebenen (englisch: Internally Displaced Persons, IDP) sind die jeweiligen Staaten selbst verantwortlich, die dieser Aufgabe aber häufig nicht nachkommen können oder wollen. Internationale Unterstützung erhalten Binnenvertriebene nur, wenn ihre Regierung dem zustimmt.
Um die Rechte von Binnenvertriebenen zu stärken, haben die Vereinten Nationen Leitlinien zu Binnenvertreibung (Externer Link) (Guiding Principles on Internal Displacement) entwickelt. Bei den Leitlinien handelt es sich jedoch nur um Empfehlungen für Regierungen und Flüchtlingsorganisationen. Sie sind rechtlich nicht bindend.
Der Begriff Biodiversität oder biologische Vielfalt umfasst die Vielfalt der Ökosysteme, der Tier- und Pflanzenarten und die genetische Vielfalt. Nach wissenschaftlichen Schätzungen befinden sich rund 80 Prozent der heute auf der Erde vorhandenen biologischen und genetischen Ressourcen in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Doch seit einigen Jahrzehnten vermindert sich weltweit die Biodiversität mit bedenklicher Geschwindigkeit: Natürliche Lebensräume werden vernichtet und die Aussterberate von Tieren und Pflanzen ist heute durch menschlichen Einfluss bis zu zehntausendmal höher als unter natürlichen Bedingungen.
Zusammen mit der Bewältigung des Klimawandels (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist der Erhalt der biologischen Vielfalt eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Die Lösung beider Herausforderungen entscheidet darüber, welche Entwicklungs- und Anpassungsmöglichkeiten wir nachfolgenden Generationen offen halten.
Der Erhalt der Biodiversität ist in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ein Querschnittsthema, das bei allen Vorhaben berücksichtigt wird, und zugleich ein eigenes entwicklungspolitisches Arbeitsfeld. In diesem Arbeitsfeld werden Strategien und Arbeitsweisen entwickelt, um Ökosysteme in ihrer Gesamtheit zu bewahren und nachhaltig zu nutzen.
Ausführliche Informationen über entwicklungspolitische Ansätze zum Erhalt der Biodiversität finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Das wichtigste internationale Abkommen zum Schutz der Biodiversität (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD), auch als Biodiversitätskonvention bekannt. Es wurde 1992 in Rio de Janeiro verabschiedet. Bislang sind dem Abkommen 196 Staaten (inklusive der Europäischen Union) beigetreten (Stand: Juli 2024).
Die drei gleichberechtigten Ziele der Konvention sind:
- der Schutz der Biodiversität (Ökosysteme, Arten und genetische Vielfalt innerhalb der Arten),
- die nachhaltige (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Nutzung der biologischen Vielfalt sowie
- die gerechte Aufteilung der Gewinne, die aus der Nutzung genetischer Ressourcen entstehen.
Die CBD geht also über den reinen Naturschutz hinaus und verfolgt auch wirtschaftliche und soziale Ziele. Grundgedanke ist dabei, dass die biologische Vielfalt nur dann langfristig erhalten werden kann, wenn die Chancen und Gewinne aus der nachhaltigen Nutzung der Natur allen beteiligten Gruppen gleichermaßen zugutekommen.
Alle zwei Jahre treffen sich die Vertragsstaaten der CBD zur Weltnaturkonferenz, um den Stand der Umsetzung zu diskutieren und dem Prozess neue Impulse zu verleihen. Mit dem Beitritt zur CBD verpflichten sich die Vertragsstaaten auch, die Entwicklungsländer beim Erreichen der Konventionsziele zu unterstützen.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Mit der Anwendung gentechnischer Methoden in der Landwirtschaft werden große Hoffnungen für die Welternährung verknüpft. Ihre Einführung kann jedoch weitreichende ökologische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Konsequenzen haben. Deshalb müssen die von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) ausgehenden Risiken überprüft werden, bevor diese in den Verkehr gebracht werden.
Die biologische Sicherheit gentechnisch veränderter Organismen ist ein wichtiger Bereich des entwicklungspolitischen Engagements Deutschlands im Arbeitsfeld Umwelt- und Ressourcenschutz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Deutschland unterstützt seine Partnerländer bei der Umsetzung des Cartagena-Protokolls (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), in dem verbindliche Regeln über den grenzüberschreitenden Handel mit GVO festgelegt sind.
Der Boden ist als Grundlage für Ackerbau und Viehwirtschaft eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen des Menschen. Doch vor allem in den Trockengebieten Afrikas, Asiens und Südamerikas werden Böden großflächig durch eine zu intensive landwirtschaftliche Nutzung zerstört. Derartig übernutzte Böden können nicht mehr genügend Wasser speichern, werden vom Wind abgetragen, versalzen oder versanden. Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) setzt sich aktiv für den Erhalt der Böden ein. Deutsche Expertinnen und Experten beraten zum Beispiel Regierungen bei der Erarbeitung von Bodenreformen und entwickeln gemeinsam mit Bauern und Viehzüchtern schonende Verfahren der Bewirtschaftung.
Das könnte Sie auch interessieren:
Der Boden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist als Grundlage für Ackerbau und Viehwirtschaft eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen des Menschen. Doch gutes Acker- und Weideland wird immer knapper: In den vergangenen 30 Jahren wurden auf rund 30 Prozent der weltweiten Landoberfläche Böden so geschädigt, dass sie ihre ökologischen und ökonomischen Funktionen nur noch vermindert oder gar nicht mehr erfüllen können.
Dieser Prozess wird als Bodendegradation bezeichnet. Laut Definition der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) können sechs spezifische Phänomene dazu beitragen: Wassererosion, Winderosion, Vernässung und Versalzung, chemische Degradation, physikalische Degradation und biologische Degradation. Im Unterschied zum umfassenderen Begriff der Desertifikation (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bezieht sich Bodendegradation vorrangig auf die Fruchtbarkeit und Produktivität des Bodens.
Bodendegradation kann natürliche Ursachen haben, ist aber in zunehmendem Maße vom Menschen verursacht. Einseitiger Anbau, falsche Bewässerung, unverhältnismäßiger Einsatz von Pestiziden, intensive Bebauung oder übermäßige Nutzung als Folge von Bevölkerungswachstum (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) stören das biologische Gleichgewicht und können Böden unbrauchbar machen. Besonders in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sind sehr viele Menschen davon betroffen, da sie direkt oder indirekt von der Landwirtschaft abhängig sind. Der Schutz der Böden und der Kampf gegen Bodendegradation und Desertifikation sind daher wichtige Aufgaben der Entwicklungspolitik. Deutschland ist in diesem Bereich einer der größten Geber weltweit.
Die Bremer Arbeitsgemeinschaft für Überseeforschung und Entwicklung (Bremen Overseas Research and Development Association, BORDA) ist eine zivilgesellschaftliche (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Organisation, die 1977 von entwicklungspolitisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern in Bremen gegründet wurde. BORDA strebt die Verbesserung der Lebensqualität benachteiligter Gruppen an. Dazu baut sie in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) dezentrale Dienstleistungen und Infrastruktur zur Grundversorgung auf. Arbeitsschwerpunkte von BORDA sind unter anderem Wasser- und Energieversorgung im ländlichen Raum, Abwasser- und Abfallmanagement sowie sanitäre Grundversorgung.
- Externer Link: Website von BORDA (Externer Link)
Das könnte Sie auch interessieren:
Im Juli 1944 kamen im US-amerikanischen Bretton Woods die Vertreter von 44 Staaten zu einer Konferenz zusammen. Vor dem Hintergrund der schwierigen weltwirtschaftlichen Lage zum Ende des Zweiten Weltkriegs verhandelten sie darüber, wie die internationalen Währungs-, Handels- und Wirtschaftsbeziehungen stabilisiert werden könnten.
Die Gesamtheit der damals geschaffenen Übereinkommen und Institutionen wird auch als Bretton-Woods-System bezeichnet. Dessen Kern war das Bretton-Woods-Abkommen. Es sah vor, dass der US-Dollar als Leitwährung in einem System fester Wechselkurse den internationalen Zahlungsverkehr absichern sollte. Das Abkommen wurde jedoch zu Beginn der siebziger Jahre aufgegeben. Andere Vereinbarungen, etwa die Gründung der sogenannten Bretton-Woods-Institutionen Internationaler Währungsfonds (IWF) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie die Schaffung von Regeln für den internationalen Handel, sind bis heute gültig oder wurden weiterentwickelt.
Deutschland trat den Bretton-Woods-Institutionen 1952 als 54. Mitglied bei. Inzwischen umfasst der IWF 190, die Weltbank 189 Mitgliedsstaaten.
Das könnte Sie auch interessieren:
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst ist das Entwicklungswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Es entstand aus dem Zusammenschluss des bei der Diakonie angesiedelten Hilfswerks „Brot für die Welt“ mit dem Evangelischen Entwicklungsdienst (EED). In mehr als 90 Ländern befähigt Brot für die Welt arme und ausgegrenzte Menschen, aus eigener Kraft ihre Lebenssituation zu verbessern. Zentraler Arbeitsschwerpunkt ist die Ernährungssicherung.
- Externer Link: Website von Brot für die Welt (Externer Link)
Unter Budgethilfe versteht man den direkten Transfer von Finanzmitteln in den Staatshaushalt eines Partnerlandes. Das Geld wird nicht für einzelne, exakt definierte Projekte der Entwicklungszusammenarbeit bewilligt. Stattdessen kann die Partnerregierung selbst entscheiden, wie sie die Mittel für die nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ihres Landes einsetzt. Budgethilfe soll die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit verbessern und die Eigenverantwortung der Partnerregierung stärken.
Korruption und Misswirtschaft in Empfängerländern führten in der Vergangenheit dazu, dass viele Geberländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ihre Budgethilfe vorübergehend oder ganz einstellten. Wird sie bewilligt, ist sie daher in der Regel mit Auflagen, Maßnahmen zur Förderung einer guten Regierungsführung und einem engen politischen Dialog verbunden.
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ist eine Fachbehörde des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Sie unterstützt Bundesministerien und nachgeordnete Behörden, EU-Institutionen und die Wirtschaft in Fachfragen. Die BGR ist die Durchführungsorganisation (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) des BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) für die technische Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) im Geosektor. Sie führt im Auftrag des BMZ Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern durch, zum Beispiel in den Bereichen Bergbau, Umweltgeologie und Georessourcenmanagement (Wasser, Boden, mineralische Rohstoffe und Energierohstoffe).
- Externer Link: Website der BGR (Externer Link)
Die Bundesentwicklungsministerin ist verantwortlich für die politische Leitung und Steuerung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Seit Mai 2025 ist Reem Alabali Radovan Bundesentwicklungsministerin.
Weitere Informationen über die Bundesentwicklungsministerin finden Sie hier.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist zuständig für die deutsche staatliche Entwicklungspolitik. Zu seinen Aufgaben zählt es, Leitlinien und Konzepte zu entwickeln, langfristige Strategien für die Kooperation mit Partnern festzulegen und Regeln für die Umsetzung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu definieren.
Politisch und finanziell liegt der Schwerpunkt der deutschen Entwicklungspolitik auf der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit mit ausgewählten Entwicklungsländern. Das BMZ beauftragt die Durchführungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) mit der Realisierung der Vorhaben und kontrolliert die Ergebnisse ihrer Arbeit.
Das BMZ setzt sich darüber hinaus auf europäischer und globaler Ebene für eine zukunftsweisende Ausgestaltung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ein. Das Ministerium bringt die Positionen der Bundesregierung in die multilateralen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Institutionen ein und engagiert sich für eine effizientere Arbeitsweise. Außerdem kooperiert das BMZ eng mit nichtstaatlichen Akteuren wie politischen Stiftungen, kirchlichen Einrichtungen und weiteren Nichtregierungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Bundesministerin Reem Alabali Radovan leitet das BMZ. Das BMZ beschäftigt im Inland gegenwärtig etwa 1.184 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Dienstsitzen in Bonn und Berlin. Ein Teil der Belegschaft verlässt zudem regelmäßig für einige Jahre das Ministerium, um weltweit für die Entwicklungspolitik tätig zu sein. Dies sind derzeit rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMZ.
Ausführliche Informationen über das BMZ finden Sie hier.
Das Büro der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zur Reduzierung von Katastrophenrisiken (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR; früher: United Nations International Strategy for Disaster Reduction, UNISDR) wurde im Anschluss an die Internationale Dekade zur Reduzierung von naturinduzierten Katastrophen (1990–1999) gegründet. Das UNDRR-Büro in Genf koordiniert alle Aktivitäten der verschiedenen UN-Einrichtungen zur Reduzierung von Katastrophenrisiken. Es entwickelt Strategien für Katastrophenrisikomanagement und setzt sich dafür ein, dass das Thema international mehr Beachtung findet. Das UNDRR unterstützt die Umsetzung, Überprüfung und internationale Koordination des Sendai-Rahmenwerks für Katastrophenvorsorge (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Büro des Hochkommissars für Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR) ist das zentrale Organ der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (UN) für den Menschenrechtsschutz. Es soll unter anderem weltweit den Schutz der Grundrechte fördern, die Menschenrechtsarbeit der Vereinten Nationen koordinieren und Regierungen bei der Umsetzung von Menschenrechten beraten. Das Büro wird vom Hochkommissar für Menschenrechte geleitet und gehört zum UN-Sekretariat, dem ständigen Verwaltungsorgan der Vereinten Nationen.
- Externer Link: Website des OHCHR (englisch) (Externer Link)
Das Büro für Drogenkontrolle und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) vereint mehrere, ehemals getrennte UN-Programme unter einem Dach. Hauptarbeitsbereiche des UNODC sind: Analyse- und Forschungsarbeit zu Drogen- und Verbrechensfragen und Polizeiarbeit, Begleitung der Umsetzung internationaler Abkommen und die technische Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) mit Staaten im Kampf gegen Drogen, Korruption (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Verbrechen und Terrorismus.
Das UNODC gehört zu den wichtigsten Partnern Deutschlands im Bereich der „Alternativen Entwicklung“. Ziel dieses Konzepts ist, legale wirtschaftliche Alternativen zum Anbau von Drogenpflanzen zu schaffen, die den Lebensunterhalt der kleinbäuerlichen Familien in den Drogenanbaugebieten sichern.
- Externer Link: Website des UNODC (englisch) (Externer Link)
Das Büro für Projektdienste der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (United Nations Office for Project Services, UNOPS) mit Sitz in Kopenhagen ist eine unabhängige Dienstleistungsorganisation innerhalb des UN-Systems. Es verbindet UN-Grundsätze mit privatwirtschaftlicher Effizienz. Das UNOPS finanziert selbst keine Projekte, sondern wird von UN-Einrichtungen und anderen Gebern mit der Durchführung von Entwicklungsprogrammen beauftragt. Außerdem nimmt das UNOPS eine zentrale Rolle im Beschaffungswesen des UN-Systems ein. Das Büro finanziert sich über seine Einnahmen vollständig selbst.
- Externer Link: Website von UNOPS (englisch) (Externer Link)
Capacity Development (frei übersetzt: Kapazitätsaufbau) beschreibt einen Prozess, durch den Menschen, Organisationen und Gesellschaften ihre Fähigkeiten mobilisieren, anpassen und ausbauen, um ihre eigene Entwicklung nachhaltig (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu gestalten und sich an verändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Hierzu gehört es, Entwicklungshindernisse zu erkennen, Lösungsstrategien zu entwickeln und diese dann erfolgreich umzusetzen.
Der Begriff ist zu einem festen Bestandteil der entwicklungspolitischen Fachsprache geworden.
Der Deutsche Caritasverband ist ein Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in Deutschland. Caritas international ist das weltweit tätige Hilfswerk des Verbandes. Es hilft nach Naturkatastrophen und in Krisengebieten das Überleben der Menschen zu sichern. Mit sozialen Projekten unterstützt Caritas international vor allem Menschen, die besonders schutzbedürftig sind: Kinder und Jugendliche, alte und kranke Menschen sowie Menschen mit Behinderungen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Das internationale Abkommen über die biologische Sicherheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) trat 2003 in Kraft und wird nach dem Ort der letzten Verhandlungsrunde im kolumbianischen Cartagena kurz Cartagena-Protokoll genannt. Das Abkommen legt völkerrechtlich verbindliche Regeln für den grenzüberschreitenden Handel, die Handhabung und den Umgang mit lebenden gentechnisch veränderten Organismen fest. Erstmals hat dabei der Schutz von Gesundheit und Umwelt Vorrang vor wirtschaftspolitischen Erwägungen. Es gibt dementsprechend Vertragsstaaten das Recht, Auflagen oder Verbote für die Einfuhr von gentechnisch veränderten Organismen zu verhängen, auch ohne dass endgültige Beweise zu den möglichen Gefahren vorliegen. Das Cartagena-Protokoll verankert somit das Vorsorgeprinzip.
Das Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM) war eine Arbeitsgemeinschaft der GIZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) mit der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit. Bis Ende 2022 vermittelte das CIM erfahrene deutsche und europäische Fachkräfte in die Länder Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Mittel- und Osteuropas. Darüber hinaus wurden aus Deutschland zurückkehrende Migrantinnen und Migranten aus Entwicklungs- und Schwellenländern bei der Existenzgründung in ihrer Heimat unterstützt.
Die Vermittlung von Fachkräften erfolgt nun über die GIZ. Informationen dazu finden Sie hier.
Die Förderangebote für rückkehrende Fachkräfte, Diaspora-Fachkräfte, Diaspora-Organisationen und Geschäftsideen für Entwicklung sind nun an dieser Stelle vereint:
- Externer Link: Website Diaspora2030 (Externer Link)
Die Charta der Vereinten Nationen ist der Gründungsvertrag der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie schreibt die Ziele und Grundsätze der Staatengemeinschaft fest, zu denen sich alle 193 UN-Mitgliedsstaaten bekennen. Die Charta wurde 1945 von den 50 Gründungsstaaten unterzeichnet und trat im selben Jahr in Kraft. Die Vereinten Nationen sind demnach „fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren“ (Präambel). In Artikel 1 setzen sie sich das Ziel, „den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren“ und „eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied [...] zu fördern und zu festigen“.
- Externer Link: Charta der Vereinten Nationen (PDF 423 KB) (Externer Link)
Der Verein Christliche Fachkräfte International (CFI, seit 2021 unter der Dachmarke Coworkers) ist seit 1985 ein staatlich anerkannter Entwicklungsdienst. Er vermittelt Fachleute, die weltweit evangelische Kirchen und christliche Organisationen bei ihren Entwicklungsprojekten unterstützen. Zu den Arbeitsfeldern zählen unter anderem Landwirtschaft, Gesundheitsdienst, technische und handwerkliche Ausbildung, Beratung und Bildung. Schwerpunkt ist die Förderung und Ausbildung einheimischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Der Clean Development Mechanism (Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung, CDM) war Bestandteil des 1997 beschlossenen Kyoto-Protokolls (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zum Schutz des Klimas (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Er wurde eingeführt, um Industrieländern das Erreichen ihrer im Kyoto-Protokoll vereinbarten Ziele zur Verringerung des Treibhausgasausstoßes (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu erleichtern und gleichzeitig den Technologietransfer in Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu fördern. Demnach konnten Industrieländer ihren Pflichten zur Emissionsminderung auch nachkommen, indem sie entsprechende Projekte in Entwicklungsländern finanzierten. Die dort nachweislich eingesparten Emissionen konnten sie dann ihrem eigenen Emissionsbudget gutschreiben lassen.
Mit dem 2015 verabschiedeten Klimaabkommen von Paris (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) wurde ein Nachfolgeinstrument für den CDM geschaffen: der Mechanismus zur Minderung der Emissionen von Treibhausgasen und zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Thema: Klimawandel und Entwicklung
Um die Auswirkungen verschiedener Treibhausgase vergleichen zu können, wurde die Maßeinheit CO₂-Äquivalent geschaffen. Mit ihr wird die Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase im Vergleich zu derjenigen von Kohlendioxid ausgedrückt.
Compact with Africa (CwA, übersetzt: Pakt mit Afrika) ist eine Initiative der G20 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie wurde 2017 unter deutscher Präsidentschaft ins Leben gerufen, um wirtschaftliche Rahmenbedingungen und das Geschäftsumfeld für private Investitionen in reformorientierten afrikanischen Ländern zu verbessern. Gemeinsam werden dafür Reformprozesse angestoßen.
- Externer Link: Informationen der Weltbank zum G20 Compact with Africa (Externer Link) (englisch)
Die Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) ist eine globale Partnerschaft von mehr als 30 Entwicklungsorganisationen (darunter BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), GIZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und KfW (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), die sich dafür einsetzt, dass arme Menschen Zugang zu finanziellen Dienstleistungen wie Sparkonten und Krediten erhalten. Sie ist in Form eines Treuhandfonds bei der Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) angesiedelt. CGAP erforscht aktuelle Themen und Trends im Bereich der Mikrofinanzierung und macht die Ergebnisse international zugänglich. Zu den Themen zählen zum Beispiel soziale Standards für Mikrofinanzierung, Mikroversicherungen, die Förderung von Frauen und der Einsatz digitaler Technologien in der Mikrofinanzierung.
- Externer Link: Website der CGAP (englisch) (Externer Link)
Corporate Social Responsibility (Unternehmerische Sozialverantwortung, CSR) ist eine wirtschaftlich, sozial und ökologisch verantwortungsvolle Unternehmensführung, die dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) folgt. Unternehmen, die sich zu CSR bekennen, verpflichten sich zur Einhaltung ethischer, sozialer und umweltrelevanter Grundsätze bei ihrer Arbeit und ihren Beziehungen zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Lieferanten und anderen Akteuren. So kann CSR dazu beitragen, die Produktionsbedingungen und die Lebenssituation der Menschen in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu verbessern. Wichtige Bereiche sind dabei unter anderem Arbeits- und Menschenrechte, Umweltschutz, Korruptionsbekämpfung und fairer Handel.
Das könnte Sie auch interessieren:
COVAX ist eine Initiative, die einen weltweit gleichmäßigen und gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen gewährleisten will. Die Abkürzung steht für den englischen Namen „COVID-19 Global Vaccine Access“. COVAX unterstützt die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Covid-19-Impfstoffen. Entwicklungsländer werden dabei unterstützt, Impfstoffe zu beschaffen, ihre Logistik zu verbessern und Impfkampagnen umzusetzen.
Koordiniert wird die COVAX-Initiative von der Impfallianz Gavi (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), der Weltgesundheitsorganisation (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (WHO) und der Forschungsallianz CEPI.
Das könnte Sie auch interessieren:
Der Begriff „debt swap“ (auf Deutsch: Schuldenumwandlung) bezeichnet eine Entschuldung mit bestimmten Auflagen. Das Prinzip: Ein Entwicklungsland (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verpflichtet sich gegenüber Deutschland, Entwicklungsprojekte im eigenen Land zu finanzieren und erhält dafür im Gegenzug von Deutschland einen Schuldenerlass in mindestens gleicher Höhe.
Schuldenumwandlungen haben sich als wichtiges entwicklungspolitisches Instrument bewährt. Deutschland führt seit 1993 Schuldenumwandlungen auf bilateraler (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Ebene durch.
Das könnte Sie auch interessieren:
Der Begriff „demografische Dividende“ beschreibt einen wirtschaftlichen Entwicklungsschub, der durch die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung eines Landes hervorgerufen wird.
In Ländern mit geringer wirtschaftlicher Entwicklung sind die Geburtsraten oft hoch und die durchschnittliche Lebenserwartung ist vergleichsweise gering. Wenn sich die allgemeinen Lebensbedingungen verbessern, nimmt die Sterblichkeit insbesondere unter Kindern ab, wodurch die Lebenserwartung steigt. Weil die Geburtenrate zunächst hoch bleibt, wächst die Bevölkerung für einige Jahrzehnte schnell. Mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung sinken dann die Geburtenraten und damit langfristig auch das Bevölkerungswachstum.
Im Laufe dieses Prozesses wandelt sich die Altersstruktur einer Gesellschaft: Wenn die Geburtenraten sinken, steigt der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung (15 bis 65 Jahre). Gleichzeitig müssen zunächst weniger alte Menschen und Kinder versorgt werden. Dadurch steht mehr Arbeitskraft und mehr Kapital für Investitionen zur Verfügung – was einen wirtschaftlichen Wachstumsschub ermöglicht.
Damit eine demografische Dividende eintritt, muss der Staat aktiv die Voraussetzungen dafür schaffen, das Potenzial der veränderten Altersstruktur zu nutzen. Vor allem muss er für ein leistungsfähiges Bildungssystem und ausreichend Arbeitsplätze sorgen und eine gleichberechtigte Teilhabe von Mädchen und Frauen ermöglichen.
Demokratie ist das bisher einzige politische System, das Menschen politische und bürgerliche Freiheiten und das Recht auf politische Teilhabe garantiert. Wesentliche Merkmale von Demokratien sind Gewaltenteilung und -kontrolle, Rechtsstaatlichkeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), freie und faire Wahlen, Mehrparteiensysteme, gesellschaftliche Beteiligung an politischen Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen (Partizipation (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), Meinungs- und Pressefreiheit sowie die Achtung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Keine Staatsform hat sich als erfolgreicher, menschlicher und entwicklungsförderlicher erwiesen als die Demokratie.
Um politische Reformprozesse zu unterstützen, hat Deutschland mit zahlreichen Partnerländern eine Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der guten Regierungsführung (Good Governance (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) vereinbart. Das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) engagiert sich insbesondere für den Schutz der Menschenrechte, die politische Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und die Medienfreiheit.
Ausführliche Informationen über entwicklungspolitische Ansätze zur Förderung der Demokratie finden Sie hier.
Trockengebiete machen rund 40 Prozent der Landfläche der Erde aus. Sie bilden den Lebensraum für einen großen Teil der Weltbevölkerung. Von Desertifikation spricht man, wenn in diesen Gebieten die natürlichen Ressourcen Boden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Wasser (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Vegetation beeinträchtigt oder zerstört werden und sich nicht regenerieren können. Starkes Bevölkerungswachstum (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zwingen viele Menschen dazu, Acker- und Weideflächen zu stark zu beanspruchen. Die Folge: Die Böden laugen aus, versalzen oder versanden, die Vegetation geht zurück, die Wasserreserven schwinden. Das Land wird unfruchtbar und verödet.
Die 50 am wenigsten entwickelten Länder der Welt (Least Developed Countries, LDC (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) sind besonders von diesem Prozess der schleichenden Wüstenbildung betroffen. Durch Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen in ihren Kooperationsländern zielt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit darauf ab, den Teufelskreis aus Armut und Bodenzerstörung zu durchbrechen.
Das könnte sie auch interessieren:
Externer Link:
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH entstand am 1. Januar 2011 durch die Fusion der drei staatlichen Durchführungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), Deutscher Entwicklungsdienst (DED (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und InWEnt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH). Die GIZ bündelt die Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen dieser drei Organisationen.
Als Bundesunternehmen unterstützt die GIZ die Bundesregierung bei der Erreichung ihrer entwicklungspolitischen Ziele. Sie fördert die internationale Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und die internationale Bildungsarbeit. Grundlage sind die Grundsätze und Ziele, die das BMZ für die deutsche Entwicklungspolitik formuliert.
Die GIZ hat Sitze in Bonn und Eschborn sowie weitere Standorte in verschiedenen Bundesländern.
- Externer Link: Website der GIZ (Externer Link)
Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) gibt es seit dem 1. Januar 2011 nicht mehr. Sie ist – gemeinsam mit dem DED (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Deutscher Entwicklungsdienst) und InWEnt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH) – in der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) aufgegangen.
Die GTZ war seit 1975 weltweit auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Sie war ein privatwirtschaftliches Unternehmen im Besitz der Bundesrepublik Deutschland.
Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) ist ein Tochterunternehmen der KfW (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Ihre Aufgabe ist es, private unternehmerische Initiativen in Entwicklungs- und Reformländern zu fördern. Dazu stellt sie privaten Unternehmen langfristiges Kapital für Investitionen in diesen Ländern zur Verfügung. Sie engagiert sich dabei ausschließlich in Projekten, die entwicklungspolitisch sinnvoll sowie umwelt- und sozialverträglich sind.
- Externer Link: Website der DEG (Externer Link)
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist eine gemeinsame Einrichtung der deutschen Hochschulen. Er hat die Aufgabe, die Hochschulbeziehungen mit dem Ausland durch den Austausch von Studierenden und Graduierten sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu fördern. Seine Programme richten sich an Menschen im In- und Ausland.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) unterstützt entwicklungspolitisch orientierte Programme des DAAD mit eigenen Haushaltsmitteln.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Den Deutschen Entwicklungsdienst (DED) gibt es seit dem 1. Januar 2011 nicht mehr. Er ist – gemeinsam mit der GTZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) und InWEnt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH) – in der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) aufgegangen.
Der DED war einer der führenden europäischen Personalentsendedienste. Er wurde 1963 als gemeinnützige Gesellschaft gegründet. Gesellschafter war die Bundesrepublik Deutschland.
Als Dachverband deutscher Genossenschaftsorganisationen vertritt der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV) seine Mitglieder in wirtschafts-, rechts- und steuerpolitischen Belangen. In der Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sieht der DGRV seine Aufgabe darin, wirtschaftliche und soziale Entwicklung durch den Auf- und Ausbau sozialer Strukturen zu fördern. Er setzt auf lokale unternehmerische Initiative, genossenschaftlich organisierte Selbsthilfe und lokale Wirtschaftskraft. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Finanzsektor, insbesondere im Bereich Mikrofinanzen: Mit Hilfe von Spar- und Kreditgenossenschaften soll benachteiligten Personengruppen der Zugang zu sicheren Finanzdienstleistungen ermöglicht werden.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist die unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Deutschlands. Es ist gemäß den Pariser Prinzipien (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen bei der Globalen Allianz der Nationalen Menschenrechtsinstitutionen (GANHRI (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) mit A-Status akkreditiert. Zu den Aufgaben des Instituts gehören Politikberatung, Menschenrechtsbildung, Information und Dokumentation, anwendungsorientierte Forschung zu menschenrechtlichen Themen sowie die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Es wird vom Deutschen Bundestag finanziert. Zu den Aufgaben des Instituts zählt auch, die Umsetzung von Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen und des Europarates (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in Deutschland zu überwachen.
Als Mitglied der weltweiten Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung hilft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Menschen, die in Not geraten sind, etwa durch Naturkatastrophen oder bewaffnete Konflikte. Es leistet humanitäre Hilfe und unterstützt den Wiederaufbau. In Zusammenarbeit mit lokalen Schwestergesellschaften engagiert sich das DRK darüber hinaus in langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Ziel ist die Stärkung der Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und die Verbesserung der Lebensbedingungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen in den Bereichen Gesundheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Wasser (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Hygiene sowie Katastrophenvorsorge und Anpassung an den Klimawandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Die gemeinnützige Organisation Development Gateway (DG) wurde im Jahr 2000 gegründet, um durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) die „digitale Kluft“ zwischen Entwicklungs- und Industrieländern zu verringern. Die Organisation bringt öffentliche und private Partner im Internet zusammen, um ihnen Zugang zu entwicklungsrelevantem Wissen zu verschaffen. Dazu entwickelt sie Instrumente, die es ermöglichen, Daten zu sammeln, auszuwerten und zu nutzen, um faktenbasierte entwicklungsförderliche Entscheidungen treffen zu können.
Seit 2021 ist Development Gateway eine Tochtergesellschaft der Entwicklungs- und Bildungsorganisation IREX und firmiert seither unter dem Namen Development Gateway: An IREX Venture.
Externer Link: Website von Development Gateway (englisch) (Externer Link)
Dezentralisierung bedeutet nach dem Verständnis der deutschen Entwicklungspolitik, politische Entscheidungsbefugnisse, Verwaltungszuständigkeiten und staatliche Gelder von der nationalen Regierungsebene auf die Regionen und Kommunen eines Landes zu übertragen. Dadurch können staatliche Dienstleistungen verbessert, öffentliche Ressourcen transparenter, wirksamer und bedarfsgerechter eingesetzt und politische Beteiligungsprozesse gestärkt werden.
Das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) betrachtet Dezentralisierung als Schlüsselfaktor für Demokratie (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und gute Regierungsführung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Deutschland fördert in zahlreichen Kooperationsländern Dezentralisierungsprozesse, damit die Bedürfnisse der Bevölkerung bei politischen Entscheidungen besser berücksichtigt werden.
Ausführliche Informationen über das deutsche Engagement im Bereich Dezentralisierung finden Sie hier.
Der Begriff Diaspora (altgriechisch für „Zerstreuung“) bezeichnete ursprünglich eine Gruppe von Menschen, die ihre Heimat unfreiwillig verlassen mussten und über mehrere fremde Länder verstreut wurden, beziehungsweise das Gebiet, in dem diese Gruppe dann als Minderheit lebte. Lange Zeit bezog sich der Begriff vor allem auf das Exil des jüdischen Volkes. Heutzutage wird der Begriff zunehmend für Gruppen von Migrantinnen und Migranten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verwendet, die sich durch ihre gemeinsame Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Religion oder Kultur verbunden fühlen.
So definiert die Internationale Organisation für Migration (IOM) Diaspora als „Migranten oder Nachkommen von Migranten, deren Identität und Zugehörigkeitsgefühl durch ihre Migrationserfahrung und ihren Hintergrund geprägt wurden. Sie unterhalten Verbindungen zu ihren Heimatländern und zueinander, die auf einem gemeinsamen Gefühl von Geschichte, Identität oder gemeinsamen Erfahrungen im Zielland beruhen“.
„Do no harm“ heißt übersetzt „richte keinen Schaden an“. Nach dem Do-no-harm-Prinzip sollen mögliche negative Folgen von Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) frühzeitig erkannt, vermieden und abgefedert werden. Ungewollte Wirkungen können zum Beispiel durch das Auftreten von ausländischen Expertinnen und Experten, die Verteilung von Fördermitteln und die Auswahl lokaler Kooperationspartner erzeugt werden. In Kriegs- oder Spannungsgebieten kann Entwicklungszusammenarbeit so schlimmstenfalls zur Eskalation von Konflikten beitragen. Vor allem Programme in Krisensituationen müssen daher nach diesem Prinzip „konfliktsensibel“ gestaltet werden.
Eine Dreieckskooperation ist ein gemeinsam geplantes, finanziertes und durchgeführtes Entwicklungsprojekt von drei Partnern:
- einem begünstigten Entwicklungsland (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), das Unterstützung bei der Bewältigung einer konkreten Entwicklungsherausforderung angefragt hat,
- einem Hauptpartner, der im eigenen Land Erfahrungen bei der Bewältigung einer solchen Herausforderung gesammelt hat und seine finanziellen Ressourcen und sein Wissen teilt,
- einem unterstützenden Partner, der dabei helfen kann, die anderen Partner zu verbinden und diese Partnerschaft finanziell und/oder mit fachlicher Expertise ergänzt.
Haupt- und unterstützender Partner können sowohl Industrie- als auch Entwicklungs- oder Schwellenländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sein. Die Rollen in einer Dreieckskooperation sind nicht starr festgelegt, jeder der beteiligten Partner kann sowohl Begünstigter als auch Wissensträger oder Unterstützer sein.
Ausführliche Informationen über Dreieckskooperation finden Sie hier.
Das BMZ beauftragt die Durchführungsorganisationen mit der Umsetzung der entwicklungspolitischen Vorhaben der Bundesregierung. Zu den Aufgaben dieser Organisationen gehören unter anderem:
- die Durchführung von Projekten der finanziellen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der technischen Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- die Vorbereitung und Entsendung von deutschen Fachkräften und Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfern
- die berufliche Fortbildung von Fach- und Führungskräften aus den Partnerländern
Die einzelnen Durchführungsorganisationen haben hoch spezialisierte Fähigkeiten entwickelt und kooperieren bei ihrer Arbeit in den Partnerländern miteinander.
Der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) engagiert sich auch international in der Erwachsenenbildung. In Entwicklungs- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Transformationsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) fördert das Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV International) mit Unterstützung des BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) die Grund- und Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen, die Aus- und Fortbildung von Fachkräften sowie die Stärkung von Strukturen der Erwachsenenbildung.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Die DW Akademie ist Deutschlands führende Organisation für internationale Medienentwicklung. Sie ist eine Einrichtung des öffentlich-rechtlichen Auslandssenders Deutsche Welle (DW).
In Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika, im Nahen Osten und in Zentralasien fördert die DW Akademie die Entwicklung freier und transparenter Mediensysteme. Gemeinsam mit lokalen Partnern setzt sie sich für bessere politische und rechtliche Rahmenbedingungen ein, stärkt verantwortungsvollen und vielfältigen Journalismus und unterstützt die Aus- und Fortbildung von Medienschaffenden.
- Externer Link: Website der DW Akademie (Externer Link)
Die internationale Bildungsinitiative Education for All – Fast Track Initiative (sinngemäß: Bildung für alle – Schnellspur-Initiative, EFA-FTI) wurde 2002 gestartet, um allen Kindern weltweit den Zugang zu qualitativ hochwertiger und kostenfreier Grundbildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu ermöglichen.
2011 wurde EFA-FTI in Global Partnership for Education (Globale Partnerschaft für Bildung, GPE (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) umbenannt.
Das könnte Sie auch interessieren:
Im jährlichen Bundeshaushaltsplan der Bundesrepublik Deutschland wird der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als Einzelplan 23 geführt. Er führt alle Einnahmen und Ausgaben des BMZ nach Herkunft und Bestimmung auf.
Für das Haushaltsjahr 2025 stehen dem BMZ insgesamt rund 10,3 Milliarden Euro zur Verfügung.
Ausführliche Informationen über den BMZ-Haushalt finden Sie hier.
EITI steht für „Extractive Industries Transparency Initiative“, auf Deutsch „Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft“. Ziel von EITI ist es, die Transparenz der Geldströme bei der Förderung von Öl, Gas, Kohle und anderen mineralischen Rohstoffen zu erhöhen und dadurch den Zivilgesellschaften (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu ermöglichen, den Verbleib der Gelder zu kontrollieren. Die Initiative wurde 2002 auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in Johannesburg ins Leben gerufen.
- Externer Link: Website der EITI (englisch) (Externer Link)
Der Begriff Empowerment stammt ursprünglich aus dem Bereich der Psychologie und Sozialpädagogik, er lässt sich am besten mit „Selbstbemächtigung“ oder auch „Selbstkompetenz“ übersetzen. Empowerment umfasst Strategien und Maßnahmen, die Menschen dabei helfen, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen. Durch Empowerment sollen sie in die Lage versetzt werden, ihre Belange zu vertreten und zu gestalten.
In der Entwicklungszusammenarbeit versteht man unter Empowerment vor allem einen Prozess, der das Selbstvertrauen benachteiligter Bevölkerungsgruppen stärkt und sie in die Lage versetzt, ihre Interessen zu artikulieren und sich am politischen Prozess zu beteiligen. Im Mittelpunkt steht dabei die Stärkung der vorhandenen Potenziale der Menschen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Veränderungen der sozialen, ökonomischen, rechtlichen und politischen Institutionen innerhalb der Gesellschaft notwendig. Die Entwicklungszusammenarbeit fördert solche Reformen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Ohne Energie ist Entwicklung nicht möglich: Energie ist Voraussetzung dafür, dass Betriebe produzieren können und Arbeitsplätze entstehen. Sie wird benötigt, um Lebensmittel anzubauen, Nahrung zuzubereiten, Wohnungen und Schulen zu heizen, Krankenhäuser zu betreiben und um sauberes Trinkwasser bereitzustellen. Energie ermöglicht weltweite Kommunikation und Mobilität.
Weltweit haben jedoch Hunderte Millionen Menschen keinen Zugang zu Elektrizität. Mehr als zwei Milliarden Menschen stehen keine sauberen Kochgelegenheiten zur Verfügung – sie verfeuern Holz, Kohle oder Kerosin, um Mahlzeiten zuzubereiten. Der Auf- und Ausbau einer nachhaltigen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Energieversorgung ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Armutsbekämpfung und die Verwirklichung der globalen Entwicklungsziele der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Zugleich müssen entschlossene Maßnahmen ergriffen werden, um den weltweiten Energieverbrauch zu senken, den Klimawandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) aufzuhalten und die lokale Umwelt zu schonen.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) fördert in zahlreichen Partnerländern Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energie und zur Verbesserung der Energieeffizienz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Auch regionale und globale Programme mit dieser Zielsetzung werden unterstützt.
Ausführliche Informationen über das Thema Energie finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung eines nachhaltigen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Energiesystems ist die Energieeffizienz. Energie (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) muss auf eine Weise erzeugt, übertragen und genutzt werden, bei der mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Leistung erreicht wird. Dazu muss unter anderem der Wirkungsgrad von Kraftwerken verbessert werden und Transportverluste durch veraltete Leitungssysteme und Verschwendung durch ineffiziente Endgeräte oder falsches Nutzerverhalten müssen vermindert werden. In solchen vermeidbaren Energieverlusten liegt ein riesiges Einsparpotenzial. Deutschland berät seine Partnerländer beim Aufbau effizienter Versorgungssysteme und unterstützt sie bei der Modernisierung von Stromnetzen und Kraftwerken.
Ausführliche Informationen über das Thema Energieeffizienz finden Sie hier.
Engagement Global – Service für Entwicklungsinitiativen ist seit Januar 2012 die zentrale Servicestelle der Bundesregierung für zivilgesellschaftliches (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und kommunales Engagement. Ihre Aufgabe ist es, engagierten Akteurinnen und Akteuren Information, Beratung, Förderung und Qualifizierung aus einer Hand anzubieten. Die Servicestelle bündelt alle Förderprogramme für Kommunen, Nichtregierungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Vereine, Unternehmen, Schulen und Einzelpersonen, die sich in der Entwicklungszusammenarbeit oder der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit engagieren wollen.
- Externer Link: Website von Engagement Global (Externer Link)
Mit dem Begriff Enklavenökonomie (auch: Wirtschaftsenklave) bezeichnet man den Einschluss eines Wirtschaftskomplexes in eine regionale oder nationale Wirtschaft, ohne dass daraus eine Wertschöpfungskette (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) entsteht. Dieser Wirtschaftsbereich besteht abgekoppelt von Gesellschaft und sonstiger Ökonomie und ist oft den Preisschwankungen auf den Weltmärkten ausgesetzt. Wird zum Beispiel der Bergbau in einem Land als Enklavenökonomie bezeichnet, bedeutet dies, dass der Sektor kaum in vor- oder nachgelagerte lokale Wirtschaftsbereiche eingebunden ist. Weder werden die für den Abbau notwendigen Maschinen und Werkzeuge im Land hergestellt, noch die gewonnenen Rohstoffe dort weiterverarbeitet.
Hohe Schulden stellen in vielen armen Ländern ein Entwicklungshindernis dar: Durch die Verpflichtung zu erheblichen Zins- und Tilgungszahlungen fehlt ihnen das Geld für dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur. Ziel einer Entschuldung ist, das Maß der Schuldenlast auf ein ökonomisch tragbares Niveau zu senken und so einen wirtschaftlichen Neubeginn möglich zu machen. Die Erfahrungen mit der 1996 gestarteten Entschuldungsinitiative für hoch verschuldete arme Länder („heavily indebted poor countries“; HIPC-Initiative (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) haben gezeigt, dass der Schuldenerlass ein wirkungsvoller Weg ist, arme Länder zu entlasten und frei werdende Mittel der Armutsbekämpfung zuzuführen. An Entschuldung sind strenge Auflagen geknüpft.
Zahlen die Entwicklungsländer ihre Schulden aus den von Deutschland gewährten Krediten zurück?
Ja, grundsätzlich zahlen die Entwicklungsländer ihre Schulden aus den von Deutschland gewährten Krediten zurück. Das ist auch im Eigeninteresse der Länder. Sie bewahren so das Vertrauen aller Gläubiger. Ansonsten könnten sie ihren Zugang zu Finanzmärkten verlieren und weniger attraktiv für Investitionen werden. Das könnte ihrer wirtschaftlichen Entwicklung dauerhaft schaden.
Es liegt aber auch in der Verantwortung der Gläubiger, ihre Kreditvergabe derart zu gestalten, dass sie nicht die Schuldentragfähigkeit eines Landes untergraben. Die G20 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Länder haben hierzu 2017 unter deutscher G20-Präsidentschaft die „G20 Operational Guidelines for Sustainable Financing“ verabschiedet.
Können Schulden auch mal nicht zurückgezahlt werden?
Es kann Situationen geben, in denen Staaten ihre Verpflichtungen nicht begleichen können. Beispielsweise können Naturkatastrophen, Pandemien oder Kriege öffentliche Haushalte aus der Bahn werfen, wenn Steuereinnahmen einbrechen oder zusätzliche Ausgaben erforderlich sind.
Wenn Staaten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, müssen in Abwesenheit eines geregelten Staateninsolvenzverfahrens auf politischer Ebene Möglichkeiten ausgelotet werden, Umschuldungen oder, falls notwendig, auch Erlasse mit den Schuldnerländern zu vereinbaren. Deutschland handelt in solchen Situationen nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen internationalen Gebern und Finanzinstitutionen (wie Internationaler Währungsfonds (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), um faire Lösungen zu finden. Umschuldungen oder Schuldenerlasse dienen nicht nur der wirtschaftlichen Stabilisierung von Schuldnerländern. Sie sind auch im Interesse der Gläubiger, die so sicherstellen, dass ein Teil der Schulden zurückbezahlt wird, die betroffenen Staaten handlungsfähig bleiben und wirtschaftliche Beziehungen zum beiderseitigen Vorteil aufrechterhalten werden können.
Schuldenumwandlungen
Deutschland bietet in ausgewählten Fällen auch bilaterale Schuldenumwandlungen, sogenannte „Debt Swaps (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)“, an. Bei Schuldenumwandlungen handelt es sich primär um ein entwicklungspolitisches Instrument. Es kommt nur für Länder infrage, die nicht überschuldet sind. Das jeweilige Land kann einen Teil seiner Schulden gegen die Verpflichtung eintauschen, Investitionen in nachhaltige Entwicklung im gleichen Wert vorzunehmen. Ein Beispiel sind „Debt-for-Climate Swaps“, bei denen sich beide Staaten auf konkrete Projekte zum Klimaschutz oder zur Klimaanpassung einigen. Erst nachdem die Projekte erfolgreich umgesetzt sind, gelten die Schuldendienstleistungen gegenüber Deutschland in derselben Höhe als beglichen. Das Geld wird also reinvestiert. Deutschland kann Partnerländern jährlich Schuldenumwandlungen in Höhe von insgesamt bis zu 150 Millionen Euro anbieten.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die entwicklungspolitische Zielsetzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) führte 1961 zur Einrichtung eines Fachausschusses für Entwicklungszusammenarbeit (englisch: Development Assistance Committee, DAC). Dem Ausschuss gehören mittlerweile 32 der 38 OECD-Mitgliedsländer an. Ihr Ziel ist, die Entwicklungszusammenarbeit qualitativ und quantitativ zu verbessern. Kernfunktionen des DAC sind:
- die Festlegung von Qualitätsstandards für die Entwicklungszusammenarbeit,
- die Erarbeitung und Abstimmung von Grundsätzen und Leitlinien für wichtige Bereiche der Entwicklungspolitik,
- die regelmäßige Überprüfung der Entwicklungspolitik der DAC-Mitglieder auf Grundlage der gemeinsamen Standards und Leitlinien („Peer Reviews“),
- die Festlegung, Überprüfung und Weiterentwicklung der Kriterien für die Anrechenbarkeit der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die Veröffentlichung der offiziellen ODA-Statistik sowie die Analyse der Ergebnisse und Trends.
Das deutsche Entwicklungshelfer-Gesetz (EhfG) definiert den Begriff des Entwicklungshelfers als Person, die in Entwicklungsländern ohne Erwerbsabsicht einen mindestens einjährigen Dienst leistet, „um in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zum Fortschritt dieser Länder beizutragen“. Das Gesetz bestimmt die Voraussetzungen für die staatliche Anerkennung und Förderung der Träger des Entwicklungsdienstes. Darüber hinaus gibt es die Rahmenbedingungen für die Dienstverträge mit den Entwicklungshelfern vor und regelt deren soziale Absicherung.
In Deutschland gibt es sieben staatlich anerkannte Träger des Entwicklungsdienstes, die Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer entsenden dürfen. Sie haben sich in der Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungsdienste (AGdD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) zusammengeschlossen.
- Externer Link: Entwicklungshelfer-Gesetz (EhfG) (PDF 69 KB) (Externer Link)
Für den Begriff „Entwicklungsländer“, der in Deutschland seit den 1950er Jahren verwendet wird, gibt es keine einheitliche Definition. Die Mehrzahl dieser Staaten weist jedoch einige dieser gemeinsamen Merkmale auf:
- eine schlechte Versorgung großer Gruppen der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, dadurch Unterernährung und Hunger
- ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen, Armut
- keine oder nur eine mangelhafte Gesundheitsversorgung, eine hohe Kindersterblichkeitsrate und eine geringe durchschnittliche Lebenserwartung
- mangelhafte Bildungsmöglichkeiten, eine hohe Analphabetenquote
- hohe Arbeitslosigkeit, ein insgesamt niedriger Lebensstandard, eine oft extrem ungleiche Verteilung der vorhandenen Güter
Die Wirtschaft der meisten Entwicklungsländer ist von einer Struktur geprägt, bei der traditionelle Produktionsweisen – vorwiegend in der Landwirtschaft – einem modernen dynamischen Sektor – meistens im Industriebereich – gegenüberstehen. Da viele Entwicklungsländer hoch verschuldet sind, leidet ihre Wirtschaft oft unter Kapitalmangel und außenwirtschaftlichen Schwierigkeiten.
In der Regel findet international die Liste der Entwicklungsländer des Entwicklungsausschusses (DAC (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) Anwendung. Sie unterteilt die Länder nach Pro-Kopf-Einkommen in vier Kategorien und wird alle drei Jahre aktualisiert. Leistungen von Geberländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) an Länder dieser Liste gelten als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)).
Das könnte Sie auch interessieren:
Externer Link:
Rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 160 Ländern trafen sich 2011 zum vierten hochrangigen Forum zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit in Busan (Südkorea). Die Konferenz bestätigte die Gültigkeit der Prinzipien, die auf den vorangegangenen Foren in Paris (2005) und Accra (2008) beschlossen worden waren.
Darüber hinaus wurde mit der Abschlusserklärung von Busan die „Globale Partnerschaft für wirksame Entwicklungszusammenarbeit“ („Global Partnership for Effective Development Cooperation“) ins Leben gerufen. Um messbare Ergebnisse bei der Armutsbekämpfung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der nachhaltigen Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu erzielen, bezieht die Partnerschaft alle entwicklungspolitischen Akteure ein: Industriestaaten, Schwellenländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), internatioale Entwicklungsorganisationen, die Privatwirtschaft und die Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Externer Link:
Siehe auch:
Das Entwicklungspolitische Schulaustauschprogramm (ENSA) ist ein 2005 gestartetes Förderprogramm für Schulpartnerschaften mit Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika und Südosteuropa. ENSA wird im Auftrag des BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) von der gemeinnützigen Gesellschaft Engagement Global – Service für Entwicklungsinitiativen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ausgeführt.
ENSA steht allen Schulformen (Haupt-, Real-, Gesamt- und Berufsschulen sowie Gymnasien) offen. Jugendliche aus Deutschland, Transformations- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) arbeiten gemeinsam in Projekten zu entwicklungspolitischen Themen. Im Anschluss an die Begegnungsreisen setzen sie sich als Multiplikatoren für das Bildungskonzept des „Globalen Lernens“ ein. Ziel von ENSA ist es, ein wachsendes Netzwerk aus Nichtregierungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern aufzubauen, die sich für eine globale nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) engagieren.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (United Nations Development Programme, UNDP) ist ein Ausschuss der Hauptversammlung der Vereinten Nationen und die zentrale Organisation der UN-Entwicklungsfonds und -programme. Es hat eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und auch bei der Umsetzung von Reformen innerhalb des UN-Systems.
Das UNDP unterstützt Partnerländer mit Politikberatung und dem Auf- beziehungsweise Ausbau von Fähigkeiten/Kapazitäten in den Bereichen Armutsbekämpfung, struktureller Wandel für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie Krisenvorsorge und Konfliktbewältigung.
Zudem veröffentlicht das UNDP jährlich den Bericht über die menschliche Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Human Development Report, HDR). Er enthält umfangreiche Informationen zum Entwicklungsstand und zum Lebensstandard in den verschiedenen Ländern, basierend auf dem Index der menschlichen Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Human Development Index, HDI).
- Externer Link: Website des UNDP (englisch) (Externer Link)
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) hat die Aufgabe, den Menschen die Freiheit zu geben, ohne materielle Not selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihr Leben zu gestalten und ihren Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen. Sie leistet Beiträge zur nachhaltigen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Verbesserung der weltweiten wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und politischen Verhältnisse. Sie bekämpft die Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und fördert Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Rechtsstaatlichkeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Demokratie (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Entwicklungszusammenarbeit trägt zur Prävention von Krisen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und gewalttätigen Konflikten bei. Sie fördert eine sozial gerechte, ökologisch tragfähige und damit nachhaltige Gestaltung der Globalisierung.
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit basiert auf dem Grundsatz, aus ethischer Verantwortung und internationaler Solidarität zu handeln. Sie ist damit von humanistischen Werten geleitet, dient aber gleichzeitig auch dem Bestreben, die Zukunft Deutschlands zu sichern.
Als Sammelbegriff fasst Entwicklungszusammenarbeit die Leistungen der technischen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), finanziellen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und personellen Zusammenarbeit zusammen. Entwicklungszusammenarbeit ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, die von privaten und öffentlichen Einrichtungen erfüllt wird. Leistungen der Entwicklungszusammenarbeit können in materieller Form (als Kredite oder Zuschüsse) oder auch in immaterieller Form (zum Beispiel durch Bereitstellung von Know-how oder Aus- und Fortbildung) erbracht werden.
Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe?
Die deutsche Regierung betrachtet die Länder und Organisationen, mit denen sie entwicklungspolitisch zusammenarbeitet, nicht als Empfänger von Hilfsleistungen, sondern als gleichberechtigte Partner. Die Ziele der Zusammenarbeit werden gemeinsam festgelegt, die Maßnahmen werden gemeinsam geplant und verwirklicht und auch die Verantwortung für Erfolge und Misserfolge wird gemeinsam getragen. Die Partner beteiligen sich außerdem in vielen Fällen an der Finanzierung der Programme.
Darüber hinaus profitieren Deutschland und die anderen Geberstaaten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) auch selbst von Entwicklungszusammenarbeit. Sie bietet eine gute Möglichkeit, kulturelle und wirtschaftliche Kontakte zu den Partnerländern aufzubauen und verbessert die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Der Begriff Entwicklungszusammenarbeit beschreibt diese intensive, gleichberechtigte Partnerschaft viel besser als der früher übliche Begriff Entwicklungshilfe.
Ausführliche Informationen über die Arbeitsweise der deutschen Entwicklungszusammenarbeit finden Sie hier.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verabschiedete 1986 eine Erklärung über das Recht auf Entwicklung. Demnach haben alle Menschen und Völker Anspruch darauf, an einer wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entwicklung gleichberechtigt teilzuhaben, in der alle Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gewährt werden. Sie haben das Recht, diese Entwicklung selbst zu gestalten und aus ihr Nutzen zu ziehen.
2018 beauftragte der UN-Menschenrechtsrat (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines verbindlichen völkerrechtlichen Abkommens zum Recht auf Entwicklung. Ein erster Entwurf erschien 2020, ihren Abschlussbericht mit überarbeitetem und kommentiertem Vertragsentwurf legte die Arbeitsgruppe im Sommer 2023 vor. Ein Beschluss der UN-Generalversammlung steht noch aus (Stand: Oktober 2025).
Externe Links:
Die Erklärung der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) über die Rechte der Indigenen Völker (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) wurde im September 2007 durch die UN-Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) angenommen. Sie würdigt die jahrelangen Anstrengungen der Vertretungen Indigener Völker, innerhalb der internationalen Gemeinschaft ein stärkeres Bewusstsein für die Situation der Indigenen zu schaffen. Ein Drittel der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) steht im Zusammenhang mit der UN-Erklärung über die Rechte Indigener Völker. Die Erklärung ist völkerrechtlich nicht bindend, dient aber international als Empfehlung und Orientierungshilfe.
Externer Link:
Zwei Jahre nach dem ersten hochrangigen Forum zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit in Rom (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) fand 2005 eine Folgekonferenz in Paris statt. Mehr als 100 Vertreterinnen und Vertreter von Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern, von internationalen Entwicklungsorganisationen und aus Wirtschaft und Gesellschaft einigten sich in der „Erklärung von Paris“ („Paris Declaration on Aid Effectiveness“) auf fünf Grundprinzipien der wirksamen Zusammenarbeit:
- Die Eigenverantwortung der Entwicklungsländer soll gestärkt werden („Ownership“).
- Die Geber sollen Institutionen der Kooperationsländer nutzen und ihre Programme an den Strategien und Verfahren der Partner ausrichten („Alignment“).
- Die Geber sollen ihre Programme und Verfahren untereinander abstimmen („Harmonisation“).
- Der Erfolg der Maßnahmen soll nach konkreten Ergebnissen bemessen werden („Managing for Results“), nicht am finanziellen Einsatz.
- Geber- und Kooperationsländer sollen gemeinsam über ihr entwicklungspolitisches Handeln gegenüber der Öffentlichkeit und den Parlamenten Rechenschaft ablegen („Accountability“).
Trotz beachtlicher Fortchritte und weitreichender Reformen in den Folgejahren ergab ein Evaluierungsbericht der OECD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), dass nur eine der zwölf vereinbarten Zielvorgaben tatsächlich bis 2010 erreicht wurde. Insbesondere bei der Ergebnisorientierung und der gegenseitigen Rechenschaftspflicht wurden nur geringe Fortschritte erzielt.
- Erklärung von Paris über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit (PDF 395 KB) (Externer Link)
Siehe auch:
2003 fand in Rom das erste hochrangige Forum zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit statt. Industrie- und Entwicklungsländer diskutierten dort über Wege, die Zusammenarbeit effizient zu gestalten und möglichst große Wirkungen zu erzielen – auch in Krisenzeiten. In der Erklärung von Rom („Rome Declaration“) verpflichteten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihre Entwicklungszusammenarbeit künftig an Strategien und Strukturen der Entwicklungsländer anzupassen und stärker aufeinander abzustimmen.
Externer Link:
Siehe auch:
Das Recht auf Nahrung ist ein Menschenrecht (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Alle Staaten und Regierungen haben die Pflicht, dieses völkerrechtlich verankerte Recht für ihre Bürgerinnen und Bürger zu verwirklichen. Dennoch hatten laut dem Welternährungsbericht 2024 der FAO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) im Jahr 2023 weltweit etwa 2,33 Milliarden Menschen keinen regelmäßigen Zugang zu ausreichenden, sicheren und nahrhaften Lebensmitteln. Zwischen 713 und 757 Millionen Menschen litten 2023 unter Hunger (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Die Hauptursachen für diese Situation sind Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Kriege und Konflikte. Aber auch die Folgen des Klimawandels (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) tragen dazu bei.
Ernährungssicherung ist ein Schwerpunkt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie unterstützt die Partnerländer dabei, die Ernährungslage ihrer Bevölkerung zu verbessern und langfristig zu sichern, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen und Katastrophen zu erhöhen, die ländlichen Räume (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu entwickeln und die natürlichen Produktionsgrundlagen (Fischgründe, Wasser, Boden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Klima (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), biologische Vielfalt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) zu erhalten.
Ausführliche Informationen über entwicklungspolitische Ansätze zur Ernährungssicherung finden Sie hier.
- Externer Link: Bericht „The State of Food Security and Nutrition in the World (Externer Link)“ (englisch)
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) ist die größte Sonderorganisation der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie hat das Ziel, weltweit zu einem höheren Lebensstandard, zur Verbesserung der Ernährung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie zur Überwindung von Hunger (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Unterernährung beizutragen. Sie sammelt und veröffentlicht Informationen zur weltweiten Entwicklung der Land-, Forst-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft, um Versorgungskrisen rechtzeitig zu erkennen. Außerdem erarbeitet sie Strategien zur Ernährungssicherung und startet eigene Entwicklungsprogramme und -projekte.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Erneuerbare Energien (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) werden aus Quellen gewonnen, die sich kurzfristig von selbst erneuern oder deren Nutzung nicht zur Erschöpfung der Quelle beiträgt. Zu diesen nachhaltig (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zur Verfügung stehenden Energiequellen zählen Sonnenenergie, Windkraft, Erdwärme, Wasserkraft und die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnene Biomasse. Die Nutzung von erneuerbaren Energien erhöht nicht die Konzentration von Treibhausgasen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in der Atmosphäre. Sie ist darum eines der wichtigsten Instrumente zum Klimaschutz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Kleinkraftwerke auf Basis von Sonne, Wasser, Biogas oder Erdwärme können in vielen Fällen dezentral und auf wirtschaftliche sowie umwelt- und klimaschonende Weise den lokalen Energiebedarf decken. In Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) können sie somit einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung und zugleich zur Armutsminderung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) leisten.
Ausführliche Informationen über das Thema erneuerbare Energien finden Sie hier.
Die 27 Mitglieder der Europäischen Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) – jeweils eines aus jedem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) – werden als EU-Kommissare bezeichnet. Eines der Kommissionsmitglieder übernimmt das Amt der Präsidentin oder des Präsidenten der EU-Kommission und überträgt jedem der weiteren Kommissarinnen und Kommissare die Verantwortung für ein bestimmtes Ressort, zum Beispiel für für internationale Partnerschaften und Entwicklung.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) unterstützt die Länder Mittel- und Osteuropas, des Kaukasus und Zentralasiens beim Übergang zu demokratischen Strukturen und zur Marktwirtschaft. Durch ihre Investitionen fördert sie den privaten und öffentlichen Sektor, die Stärkung der Finanzinstitute und Rechtssysteme sowie Infrastrukturprojekte in den Bereichen Verkehr, Energie und Telekommunikation.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Am 4. Juni 2021 beschloss der Rat der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) die Reform der europäischen Finanzarchitektur zur Förderung der Entwicklung (European Financial Architecture for Development, EFAD). Zuvor war die Kooperation der EU-Finanzinstitutionen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit als ungeordnet und übermäßig kompliziert kritisiert worden.
Im Rahmen des Team-Europe-Ansatzes (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sollen vor allem die Europäische Investitionsbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) künftig stärker miteinander sowie mit den (Finanz-) Institutionen der Mitgliedsstaaten zusammenarbeiten. Dadurch sollen Mittel für Investitionen in Partnerländern gebündelt werden, die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit soll steigen und das finanzielle Engagement der EU soll öffentlich sichtbarer werden.
Die Europäische Gemeinschaft entstand 1957 mit den Römischen Verträgen zunächst als Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Mit Gründung der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) im Jahre 1993 (Vertrag von Maastricht) wurde die EWG in EG umbenannt. Bis 2009 verfügte die EG innerhalb der Europäischen Union über eine eigene Rechtspersönlichkeit und damit völkerrechtliche Handlungsfähigkeit. Erst mit dem Vertrag von Lissabon 2009 wurde die Existenz der EG beendet, ihre Rechtsnachfolgerin wurde die Europäische Union (EU).
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Europäische Investitionsbank (EIB) nimmt seit 1963 entwicklungspolitische Aufgaben wahr. Ihre Hauptaufgabe ist die Finanzierung von Investitionen, die das politische und wirtschaftliche Zusammenwachsen Europas fördern und den Zielen der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) dienen. Die EIB fördert Vorhaben in den potenziellen EU-Beitrittsländern, den Ländern des Nachbarschaftsraums, in Asien und dem Pazifik, Lateinamerika und der Karibik sowie in Afrika.
Insbesondere im Bereich des Klimaschutzes gehört die EIB zu den weltweit größten Gebern. Als Klimabank der EU setzt sie sich dafür ein, die Klimaziele innerhalb der Europäischen Union sowie weltweit umzusetzen. Dafür beteiligt sie sich an der Finanzierung von Klimaschutz-, Anpassungs- und anderen klimabezogenen Projekten.
Das außereuropäische Geschäft der EIB wird unter anderem durch das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI-GE) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und dessen Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung Plus (EFSD+) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) finanziert. Schwerpunktthemen sind dabei Klima und Umwelt, Infrastruktur, Privatsektorenwicklung, Innovation sowie – seit der Covid-19-Pandemie – auch Gesundheit.
- Externer Link: Website der Europäischen Investitionsbank (Externer Link)
Die Europäische Kommission ist ein politisch unabhängiges Organ, das die Interessen der gesamten Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) vertritt. Sie legt dem Europäischen Parlament (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und dem Rat der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Gesetzesvorschläge zur Abstimmung vor, setzt alle Beschlüsse um und überwacht die Einhaltung europäischen Rechts und die fristgerechte Umsetzung von Gemeinschaftsrecht in nationales Recht. Ferner führt sie den EU-Haushalt aus und verwaltet die EU-Programme. Die Kommission wurde bewusst übernational angelegt und soll von den nationalen Interessen einzelner Regierungen unabhängig sein.
Das politisch verantwortliche Beschlussgremium der Kommission ist das Kollegium der Kommissare (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), in das jedes Mitgliedsland eine Person entsendet. Zurzeit besteht das Gremium daher aus 27 Personen einschließlich der Kommissionspräsidentin. Die EU-Kommissarinnen und -Kommissare sind jeweils für fünf Jahre im Amt.
Die Präsidentin beziehungsweise der Präsident der Europäischen Kommission wird vom Europäischen Rat (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ernannt. In Abstimmung mit ihr oder ihm setzt der Europäische Rat auch die anderen Kommissarinnen und Kommissare ein. Das Europäische Parlament muss der Ernennung der Kommissionsmitglieder zustimmen und ist zudem allein befugt, sie zu entlassen. Seit Dezember 2019 ist die deutsche Politikerin Ursula von der Leyen Präsidentin der Europäischen Kommission.
Das auswärtige Handeln der EU koordiniert seit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags (2009) die Hohe Vertreterin oder der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Zurzeit bekleidet die estnische Politikerin Kaja Kallas das Amt. Sie führt den Vorsitz im Rat für Auswärtige Angelegenheiten und ist gleichzeitig Vizepräsidentin der EU-Kommission. Unterstützt wird sie vom Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Die Generaldirektionen
Die Generaldirektionen sind Verwaltungseinheiten der Europäischen Kommission, die jeweils für einen bestimmten Politikbereich zuständig sind. Jeder Kommissar steht mindestens einer Generaldirektion der EU-Kommission vor.
Richtungsweisend für die EU-Entwicklungszusammenarbeit ist vor allem die Generaldirektion „Internationale Partnerschaften“. Seit 2024 ist sie EU-Kommissar Jozef Síkela zugeordnet. Die Generaldirektion befasst sich mit der Vorbereitung und fachlichen Umsetzung aller entwicklungspolitisch relevanten EU-Maßnahmen. Zu ihren Aufgaben zählt außerdem die Zusammenarbeit mit weiteren internationalen Gebern und Institutionen, den Partnerländern und mit der Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Das könnte Sie auch interessieren:
Externe Links:
Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie die Europäische Menschenrechtskonvention offiziell heißt, wurde1950 vom Europarat (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verabschiedet und trat 1953 in Kraft. Seitdem wurde sie durch eine Reihe von Protokollen geändert und erweitert.
Basierend auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen definiert die Europäische Menschenrechtskonvention Grundrechte und -freiheiten. Dazu zählen unter anderem die Rechte auf Leben, Freiheit und Sicherheit, auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und auf Achtung des Privat- und Familienlebens sowie das Verbot von Folter, Sklaverei, Zwangsarbeit und Diskriminierung.
Die Konvention wurde von allen Mitgliedern des Europarats ratifiziert. In der Bundesrepublik Deutschland trat sie 1953 in Kraft.
Um die Einhaltung der Konvention sicherzustellen, wurde der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in Straßburg eingerichtet.
Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) ist das zentrale Instrument der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union (EU) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und ihren Nachbarstaaten. Sie wurde 2004 im Zusammenhang mit der Erweiterung der EU um zehn Mitgliedsländer entwickelt und 2015 überarbeitet. Ziel der ENP ist es, die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen und so die Entstehung neuer Trennlinien zwischen der EU und den Nachbarn zu verhindern. Die ENP richtet sich an die Staaten im südlichen und östlichen Mittelmeerraum, an Belarus, die Republik Moldau, die Ukraine sowie die Kaukasusstaaten Armenien, Aserbaidschan und Georgien.
Mit der ENP bietet die EU diesen Staaten eine privilegierte Partnerschaft an, die auf dem Bekenntnis zu gemeinsamen Werten basiert (Demokratie (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Rechtsstaatlichkeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), gute Regierungsführung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), marktwirtschaftliche Prinzipien und nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). In bilateralen Aktionsplänen, die individuell auf die einzelnen Kooperationsländer zugeschnitten sind, werden Zielvereinbarungen und vorrangige Handlungsschwerpunkte formuliert.
Das könnte Sie auch interessieren:
Externer Link:
Die Europäische Union umfasst derzeit 27 Mitgliedsstaaten. Diese haben einen Teil ihrer Hoheitsrechte an europäische Institutionen übertragen, die die gemeinschaftlichen, die nationalen und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Insgesamt gibt es sieben EU-Organe:
- Europäisches Parlament (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Europäischer Rat (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Rat der Europäischen Union (Ministerrat) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Europäische Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Gerichtshof der Europäischen Union
- Europäische Zentralbank
- Europäischer Rechnungshof
Entwicklungszusammenarbeit
Die Europäische Union betreibt eine eigenständige entwicklungspolitische Zusammenarbeit, die Teil der EU-Außenbeziehungen ist. Sie wird aus dem Haushalt der EU sowie dem gesondert bestehenden Europäischen Entwicklungsfonds (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) finanziert. Die Umsetzung erfolgt durch die Europäische Kommission in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Die EU ist in sämtlichen Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) mit eigenen Delegationen vertreten.
Die EU und ihre Mitglieder stellen zusammengenommen die meisten Mittel für Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bereit (2023: etwa 46 Prozent der weltweiten ODA (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Die Mitgliedsstaaten stimmen sich in internationalen Prozessen ab, um als EU mit einer Stimme zu sprechen. Ebenso wird die konkrete Entwicklungszusammenarbeit in den Partnerländern mit Blick auf ein arbeitsteiliges Vorgehen koordiniert.
Ausführliche Informationen über die Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union und die deutsche Mitwirkung daran finden Sie hier.
Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) ist der diplomatische Dienst der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Er wurde in seiner jetzigen Form durch den Vertrag von Lissabon (2009) geschaffen und unterstützt die Hohe Vertreterin beziehungsweise den Hohen Vertreter der EU (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bei der Umsetzung der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union.
Der EAD setzt sich aus Expertinnen und Experten des Rates der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), der Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der nationalen diplomatischen Dienste der Mitgliedsstaaten zusammen. Außerhalb ihrer Grenzen unterhält die Europäische Union in verschiedenen Ländern Vertretungsbüros (EU-Delegationen), die eine ähnliche Funktion wie Botschaften haben. Gemeinsam mit der Generaldirektion Internationale Partnerschaften (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) koordiniert der EAD die Entwicklungszusammenarbeit der EU.
- Externer Link: Website des EAD (englisch) (Externer Link)
Der Europäische Entwicklungsfonds war ein vom Haushalt der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) getrenntes Sondervermögen. Über den EEF wurde die Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der EU mit vielen Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (AKP-Staaten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) finanziert.
Seit 2021 wird die Funktion des EEF hauptsächlich durch das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI-GE) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) erfüllt. Vorhaben, die vor 2021 im Rahmen des EEFs zugesagt wurden, werden jedoch weiter umgesetzt.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die EU-Mitgliedsstaaten einigten sich 2005 auf den Europäischen Entwicklungskonsens, um grundlegende Prinzipien und Ziele der gemeinsamen Entwicklungsstrategie festzulegen. Er soll als Leitfaden aller gemeinsamen Maßnahmen dienen. Als Hauptziel wurde die weltweite Armutsbekämpfung definiert.
2017 einigte man sich auf eine Überarbeitung, um den Konsens in Einklang mit der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und dem Pariser Klimaabkommen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu bringen. Die Beseitigung von Armut steht weiterhin im Mittelpunkt. Stärker berücksichtigt werden nun außerdem Aspekte des sozial gerechten Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden Zusammenhänge zu den Themen Migration, humanitäre Hilfe, Frieden und Sicherheit berücksichtigt. Der aktuelle Europäische Entwicklungskonsens setzt folgende Schwerpunktthemen:
- Jugend
- Geschlechtergleichstellung
- Mobilität und Migration
- nachhaltige Energieversorgung und Klimawandel
- Investitionen und Handel
- verantwortungsvolle Staatsführung
- Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte
- innovative Zusammenarbeit mit weiter fortgeschrittenen Entwicklungsländern
- Mobilisierung und Nutzung der eigenen Ressourcen
Der Europäische Konsens zielt zudem auf eine Stärkung der gemeinsamen Programmplanung (Joint Programming (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und mehr politische Abstimmung (Kohärenz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) ab.
Der Europäische Fonds für nachhaltige Entwicklung Plus (European Fund for Sustainable Development plus, EFSD+) wurde im Juni 2021 im Rahmen des neuen EU-Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI – Global Europe) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) eingerichtet. Zusammen mit der Garantie für Außenmaßnahmen (External Action Guarantee, EAG) bildet der Fonds ein Finanzpaket. Dieses soll den Partnerländern der europäischen Entwicklungszusammenarbeit einen besseren Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, etwa Zuschüssen oder Haushaltsgarantien, bieten. Insbesondere sollen mit dem Paket zusätzliche Finanzmittel für eine nachhaltige Entwicklung aus dem öffentlichen Sektor und der privaten Wirtschaft mobilisiert werden.
Alle geförderten Maßnahmen müssen sich an den Zielsetzungen sowie politischen und geografischen Schwerpunkten des NDICI – Global Europe ausrichten. Der für den EFSD+ reservierte Garantierahmen beträgt mindestens 39,8 Milliarden Euro, wovon 26,7 Milliarden Euro für Vorhaben der Europäischen Investitionsbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) reserviert wurden.
Externer Link:
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg nahm 1959 seine Arbeit auf. Er ist ein Organ des Europarats (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), dem 47 Staaten mit mehr als 800 Millionen Einwohnern angehören.
Vor dem Gerichtshof können Personen gegen Mitgliedsstaaten des Europarats Klage führen. Meist geht es dabei um Verletzungen von Rechten, die durch die Europäische Menschenrechtskonvention (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) garantiert werden. In seltenen Fällen behandelt der EGMR auch Beschwerden der Mitgliedsstaaten gegeneinander. Außerdem erstellt er Gutachten zur Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Urteile des EGMR sind für die Prozessparteien verbindlich.
Externer Link:
Der Europäische Rat ist eines der sieben Organe der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Er setzt sich aus den Staats- und Regierungschefs aller EU-Mitgliedsstaaten, dem Präsidenten des Europäischen Rates und der Präsidentin der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zusammen und tagt in der Regel vierteljährlich.
Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten fest. Die durch ihn definierten Positionen bilden die Richtschnur für die Arbeit der Kommission und der Regierungen der Mitgliedsstaaten. Der Europäische Rat selbst wird nicht gesetzgeberisch tätig.
Der Präsident des Europäischen Rates wird von den Staats- und Regierungschefs für zweieinhalb Jahre gewählt.
Soweit in den Verträgen nicht anders festgelegt, entscheidet der Europäische Rat im Konsens. Je nach den Bestimmungen für das jeweilige Politikfeld werden Entscheidungen einstimmig oder mit qualifizierter Mehrheit getroffen.
- Externer Link: Website des Europäischen Rates (Externer Link)
Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte Organ der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden von den EU-Bürgerinnen und ‑Bürgern für fünf Jahre gewählt, zuletzt im Juni 2024. Das Parlament hat drei wesentliche Aufgaben: Gesetzgebung, Haushaltskontrolle und parlamentarische Kontrolle der EU-Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und des Rats der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (2009) kann das Parlament auch selbst Änderungen in EU-Verträgen vorschlagen. Zudem muss es an anderen wichtigen Entscheidungen, wie dem Beitritt neuer Länder zur EU, beteiligt werden.
Gesetzgebung
Die große Mehrheit aller Gesetze der EU werden vom Europäischen Parlament und vom Rat der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gemeinsam und gleichberechtigt erlassen. Nur in besonderen Fällen hat das Parlament lediglich eine beratende Funktion. Beim sogenannten ordentlichen Gesetzgebungsverfahren legt die EU-Kommission dem Parlament und dem Rat einen Vorschlag für eine Verordnung, eine Richtlinie oder einen Beschluss vor. In jeweils bis zu zwei Lesungen können das Parlament und der Rat Änderungen an dem vorgeschlagenen Gesetzestext einbringen. Erzielen beide Organe in zweiter Lesung keine Einigung, wird ein Vermittlungsausschuss einberufen. Ist die vom Ausschuss vereinbarte Fassung in dritter Lesung für beide Organe annehmbar, wird der Rechtsakt erlassen.
Haushaltskontrolle
Das Parlament bestimmt gleichberechtigt mit dem Rat über den gesamten EU-Haushalt. Es kann so in allen Politikbereichen darüber mitentscheiden, wie viel Geld wofür ausgegeben wird. Das Parlament begutachtet auch die Haushaltsführung der Kommission.
Parlamentarische Kontrolle
Der Lissabon-Vertrag stärkt die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber den anderen Institutionen der EU. So wurde das Mitspracherecht bei der Auswahl des Führungspersonals der EU deutlich erweitert. Das Parlament wählt den Präsidenten beziehungsweise die Präsidentin der Europäischen Kommission auf Grundlage eines Vorschlags der Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der Mitgliedsstaaten. Auch der Hohe Vertreter/die Hohe Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) benötigt die Zustimmung des Parlaments.
Eine neue EU-Kommission kann erst dann ihre Arbeit beginnen, wenn sie vom Parlament bestätigt wurde. Die Abgeordneten können die Kommission insgesamt ablehnen. Durch einen Misstrauensantrag kann das Parlament auch den Rücktritt einer amtierenden Kommission einfordern.
Entwicklungsausschuss
Innerhalb des Parlaments ist der Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit (Committee on Development, DEVE) ein besonders wichtiger Ansprechpartner für die deutsche Entwicklungspolitik. Die Mitglieder des Ausschusses übernehmen die parlamentarische Kontrollarbeit im Bereich der gesamteuropäischen Entwicklungspolitik und treten in Dialog mit den Partnerländern.
- Externer Link: Website des Europäischen Parlaments (Externer Link)
Der Europarat wurde 1949 als erste europäische Organisation der Nachkriegszeit gegründet. Ihm gehören heute 46 Staaten an, darunter auch die Türkei. Russland wurde aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine im März 2022 aus dem Europarat ausgeschlossen (Stand: März 2024).
Der Europarat ist kein Organ der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sitz der Organisation ist Straßburg in Frankreich.
Ziel des Europarats ist die Förderung der Demokratie (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie der Schutz der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der Rechtsstaatlichkeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Er hat mehr als 200 Verträge und Konventionen erarbeitet. Die Unterzeichnung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist für jeden Mitgliedsstaat verpflichtend. Beim Europarat angesiedelt ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
- Externer Link: Website des Europarats (Externer Link)
Das Europäische Amt für Zusammenarbeit (EuropeAid) wurde 2001 gegründet und war die zentrale Stelle für die praktische Umsetzung der europäischen Entwicklungspolitik. Anfang 2011 wurde EuropeAid mit der Generaldirektion Entwicklung der Europäischen Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) fusioniert. Inzwischen lautet die Bezeichnung der Fachabteilung Generaldirektion Internationale Partnerschaften (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie ist für die gesamte Programmierung und Umsetzung der europäischen Entwicklungszusammenarbeit verantwortlich.
Externer Link:
Der Europäische Grüne Deal (European Green Deal, EGD) ist ein politisches Projekt der Europäischen Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), das 2019 beschlossen wurde. Ziel des Maßnahmenpakets ist, bis 2050 Klimaneutralität in Europa zu erreichen. Bis 2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasen bereits um 55 Prozent gesenkt werden. Der EGD soll zu nachhaltigem Wachstum führen und verknüpft soziale, ökologische und wirtschaftliche Faktoren. Er ist damit ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und des Pariser Klimaabkommens (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und weist Europa eine globale Vorreiterrolle zu.
Entwicklungspolitisch bedeutsame Initiativen enthält der European Green Deal in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, erneuerbare Energien, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, entwaldungsfreie Lieferketten und nachhaltige Lebensmittelproduktion.
Ausführliche Informationen zum Thema Klimawandel und Entwicklung finden Sie hier.
Das Wort Evaluierung beziehungsweise Evaluation stammt ursprünglich aus der lateinischen Sprache und bedeutet Bewertung oder Beurteilung. Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sind Evaluierungen umfassende und systematische Erfolgskontrollen von entwicklungspolitischen Programmen, Instrumenten und Strategien. Sie dokumentieren und beurteilen, ob und wie Entwicklungsmaßnahmen ihre Ziele erreicht haben und ob sie als erfolgreich gelten können.
Für jede Evaluierung wird auf Grundlage eines allgemeingültigen Rasters ein individueller Plan erstellt. Dieses Verfahren macht es möglich, die Evaluierungsergebnisse unterschiedlicher Vorhaben miteinander zu vergleichen. Dadurch können Erfahrungen, die bei einem einzelnen Programm gesammelt wurden, auch auf andere Maßnahmen übertragen werden.
Um die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unabhängig von außen prüfen zu lassen, hat das BMZ 2012 das Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) ins Leben gerufen.
Ausführliche Informationen über die Evaluierung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit finden Sie hier.
Im Bergbau und in der Geologie wird unter diesem Begriff die Suche nach Rohstoffen in der Erdkruste und die Erschließung von entsprechenden Lagerstätten verstanden.
Die staatliche Genehmigung zur Suche nach Rohstoffen auf einer bestimmten Fläche wird als Explorationskonzession bezeichnet.
Exportkreditgarantien, auch bekannt als Hermes-Bürgschaften, sind staatliche Instrumente der Außenwirtschaftsförderung. Die Bundesrepublik Deutschland sichert damit einheimische Exporteure und Banken gegen wirtschaftliche und politische Risiken ab. Ohne diese Staatsgarantien wäre es vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht möglich, sich auch in schwierigen Märkten zu engagieren – sie wären im internationalen Wettbewerb benachteiligt.
Ein großer Teil der deutschen Ausfuhren in Entwicklungs- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Schwellenländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) wird von Hermes-Bürgschaften gedeckt. Die Bewilligung von Exportkreditgarantien ist daher unter anderem an die Berücksichtigung entwicklungspolitischer Belange geknüpft.
Der extraktive Sektor (vom lateinischen „extrahere“ = herausziehen, entnehmen) ist der Bereich der Wirtschaft, der sich mit dem Abbau beziehungsweise der Förderung und der Verarbeitung von Rohstoffen befasst. Er umfasst die mineralischen Rohstoffe (Metallrohstoffe wie Eisen und Stahl sowie Nichtmetallrohstoffe wie Steine und Erden) sowie die Energierohstoffe (fossile Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle; Kernbrennstoffe wie Uran). Nicht zum extraktiven Sektor gehören land- und forstwirtschaftliche Rohstoffe.
Das könnte Sie auch interessieren:
Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzentinnen und Produzenten und Arbeiterinnen und Arbeiter – insbesondere in den Ländern des Südens – leistet der faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Die beteiligten Handelsorganisationen vereinbaren mit den Erzeugern (Produktionsgenossenschaften, Kooperativen, sozial engagierte Unternehmen) jährlich bestimmte Mindestabnahmemengen und einen Preis für ihre Ware, der die Kosten einer sozial und ökologisch nachhaltigen Produktion abdeckt. Das BMZ unterstützt den fairen Handel in Deutschland unter anderem durch Informationskampagnen.
Ausführliche Informationen über fairen Handel finden Sie hier .
siehe Weibliche Genitalverstümmelung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (englisch: Female Genital Mutilation, FGM)
Die Financial Action Task Force (FATF) ist das wichtigste weltweite Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie wurde im Jahr 1989 durch die G7 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gegründet und hat heute 40 Mitglieder und neun Regionalorganisationen (FATF-Style Regional Bodies, FSRB). Deutschland ist Gründungsmitglied der FATF und wird in dem Gremium durch das Bundesministerium der Finanzen vertreten.
Die FATF hat international anerkannte Standards zur Vorbeugung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (Proliferation) formuliert. Um die Integrität des internationalen Finanzsystems zu schützen, fördert die FATF die weltweite Verbreitung und Weiterentwicklung dieser Standards. In regelmäßigen Abständen überprüfen die FATF und die FSRBs den Stand der Umsetzung in ihren Mitgliedsstaaten.
Mitgliedsstaaten, die strategische Defizite in ihren Regelungen zu Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung aufweisen, werden öffentlich benannt. Die identifizierten Länder sind angehalten die festgestellten Mängel anhand eines mit der FATF erarbeiteten Aktionsplans anzugehen. Mehr als 200 Länder und Gerichtsbarkeiten haben sich verpflichtet, die FATF-Standards umzusetzen.
Externe Links:
Ein funktionsfähiges Finanzsystem ist das Rückgrat jeder Volkswirtschaft. Es trägt entscheidend zum Wirtschaftswachstum eines Landes und zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung bei. Durch das Angebot von maßgeschneiderten Finanzdienstleistungen – Sparkonten, Kredite, Versicherungen und Zahlungsverkehr – können arme Bevölkerungsschichten unmittelbar bei ihrer wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwicklung unterstützt werden.
In manchen Entwicklungs- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Transformationsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist das Finanzsystem für diese Aufgabe noch nicht ausreichend differenziert, leistungsfähig und stabil. Das hemmt die Investitionstätigkeit und die Entwicklung. Denn unter einem unzureichendem Zugang zu Finanzdienstleistungen leiden oft die Bereiche, die besonders große Bedeutung für den Erfolg einer Volkswirtschaft haben: die Landwirtschaft, die Kommunalverwaltungen und die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit fördert verantwortungsvolle und leistungsfähige Finanzsysteme für Einzelpersonen, Haushalte, Unternehmen und den Staat.
Die finanzielle Zusammenarbeit hat die Aufgabe, Investitionen der Entwicklungsländer zu fördern. Das BMZ stellt hierfür günstige, zurückzuzahlende Kredite, Beteiligungskapital oder Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, zur Verfügung. Verantwortliche Organisation für die finanzielle Zusammenarbeit ist die KfW Entwicklungsbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) kümmert sich auf Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention um die Belange von Flüchtlingen und Menschen in flüchtlingsähnlichen Situationen. Das UNHCR koordiniert die internationale Flüchtlingshilfe und arbeitet dazu eng mit den UN-Schwesterorganisationen Welternährungsprogramm (WFP), Kinderhilfswerk (UNICEF) und Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammen.
Informationen über die Zusammenarbeit des BMZ mit dem UNHCR finden Sie hier.
- Externer Link: Website des UNHCR Deutschland (Externer Link)
Laut Artikel 1A der Genfer Flüchtlingskonvention (Externer Link) ist ein Flüchtling eine Person, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will“.
Ob die Furcht vor Verfolgung begründet ist, wird in einem Asylverfahren festgestellt. Diese Verfahren unterscheiden sich von Land zu Land. Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, über den noch nicht entschieden wurde, werden als Asylsuchende (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bezeichnet.
Der Wirkungsbereich der Genfer Flüchtlingskonvention ist umstritten. Die meisten großen Flüchtlingsbewegungen der vergangenen Jahre wurden durch Bürgerkriege ausgelöst.
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) vertritt die Position, dass nicht der Urheber der Verfolgung ausschlaggebend ist, sondern die Tatsache, dass eine Person internationalen Schutz benötigt, weil ihr eigener Staat diesen nicht mehr garantieren kann oder will. Diese Auffassung wird auch in der afrikanischen Flüchtlingskonvention und in der lateinamerikanischen Erklärung von Cartagena vertreten.
International gibt es keine einheitliche Definition fragiler Staatlichkeit. Generell werden jene Staaten als instabil (fragil) angesehen, in denen die Regierung nicht willens oder in der Lage ist, Grundfunktionen im Bereich Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), soziale Grundversorgung und Legitimität zu erfüllen. Die staatlichen Strukturen und Einrichtungen in fragilen Staaten sind sehr schwach oder vom Zerfall bedroht; die Bevölkerung leidet unter großer Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Gewalt und politischer Willkür. Da fragile Staaten ein regionales und globales Sicherheitsrisiko darstellen, muss die Staatengemeinschaft behutsam auf eine Verbesserung der Lage hinwirken. Dabei spielt die Entwicklungspolitik eine wichtige Rolle.
Ausführliche Informationen über das entwicklungspolitische Engagement in fragilen Staaten finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Ein Grundsatz der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist ihre Universalität, also ihre Allgemeingültigkeit: Die Menschenrechte gelten überall und für alle Menschen, unabhängig vom Geschlecht oder anderen Eigenschaften. Werden Frauen benachteiligt, ist das ein Verstoß gegen ihre Menschenrechte. Dennoch geschieht das noch immer in allen Regionen der Welt. So sind Frauen zum Beispiel einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt – die Mehrheit der in Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) lebenden Menschen ist weiblich. Weltweit erledigen Frauen den deutlich größeren Teil unbezahlter Sorge- und Pflegearbeit und sie erhalten durchschnittlich etwa 20 Prozent weniger Gehalt bei gleicher oder gleichwertiger Erwerbsarbeit als Männer. Nur etwa ein Viertel aller Parlamentsabgeordneten der Welt sind Frauen; nur wenige Frauen bekleiden das Amt einer Staats- oder Regierungschefin.
Die Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter ist ausdrückliches Ziel, übergreifende Aufgabe und Querschnittsthema der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) fördert deshalb vielfältige Maßnahmen zum Abbau der Diskriminierung von Mädchen und Frauen. Mehr zum Thema finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Volunteers, UNV) ist Teil des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Seine Zentrale ist in Bonn. Das UNV rekrutiert und vermittelt berufserfahrene Expertinnen und Experten aus Entwicklungs- und Industrieländern als Freiwillige für Einsätze in der Entwicklungszusammenarbeit. Neben der Arbeit im Bereich der technischen Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sind die Freiwilligen auch im Bereich der humanitären Hilfe und der Friedensarbeit sowie bei Menschenrechts- und Wahlmissionen im Einsatz. Partner sind dabei vor allem UN-Organisationen, aber auch andere internationale Organisationen oder Regierungen.
- Externer Link: Website des UNV (englisch) (Externer Link)
Frieden ist die Abwesenheit von gewaltsamen Konflikten oder Krieg. Er bezeichnet einen Zustand, in dem auftretenden Differenzen zwischen Einzelpersonen, Gruppen oder Staaten auf Basis von Rechten und Gesetzen und ohne Gewalt begegnet wird. Frieden und Entwicklung sind untrennbar miteinander verbunden und bedingen einander.
Ein Krieg kann die Entwicklung eines Landes oder einer Region um Jahrzehnte zurückwerfen: Der Verlust von Menschenleben kann nicht wiedergutgemacht werden und die Kosten für den Wiederaufbau der Infrastruktur sind enorm hoch. Im Rahmen ihres Einsatzes gegen Armut, Gewalt und Unrecht unterstützt die deutsche Entwicklungspolitik ihre Partnerländer bei der Friedensentwicklung durch Krisenprävention (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Konfliktbewältigung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Friedensförderung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Ausführliche Informationen zum BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Engagement für den Frieden finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Um langfristig Frieden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu schaffen, reicht es nicht, die sichtbare Gewalt zu beenden. Werden die Ursachen eines Konflikts nicht beseitigt, kann er immer wieder ausbrechen. Das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) unterstützt darum im Rahmen der Friedensförderung nicht nur die Wiederherstellung von zerstörter Infrastruktur. Es fördert auch die Arbeit von Wahrheits- und Menschenrechtskommissionen, die juristische Aufarbeitung von Kriegsverbrechen sowie Versöhnungsprojekte und Programme zur psychologischen Betreuung von Kriegsopfern.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die 1925 gegründete Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ist die älteste politische Stiftung Deutschlands. Sie steht der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) nahe. Benannt ist sie nach Friedrich Ebert, dem ersten demokratisch gewählten deutschen Reichspräsidenten. Die Stiftung engagiert sich für die politische und gesellschaftliche Bildung und trägt zur internationalen Verständigung bei.
Die FES verfügt über mehr als 100 Außenvertretungen. Im Mittelpunkt ihrer internationalen Arbeit steht die Förderung von sozialer Gerechtigkeit, Demokratie, Frieden und Sicherheit. Ein Schwerpunkt ist die Stärkung freier Gewerkschaften.
- Externer Link: Website der Friedrich-Ebert-Stiftung (Externer Link)
Die Stiftung ist nach dem liberalen Politiker Friedrich Naumann benannt. Nach dem Ersten Weltkrieg war er der erste Vorsitzende der neu gegründeten Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und Mitglied der Weimarer Nationalversammlung. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit steht der Freien Demokratischen Partei (FDP) nahe. Auf Grundlage der Idee des Liberalismus trägt sie zur politischen Bildung bei und unterstützt Menschen dabei, sich aktiv ins politische Geschehen einzubringen. In mehr als 60 Ländern fördert die Stiftung den Aufbau demokratischer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), marktwirtschaftlicher und rechtsstaatlicher (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Strukturen.
Das 2020 von der Gruppe der 20 (G20 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) verabschiedete „Common Framework for Debt Treatments“ ermöglicht für bestimmte Länder fallweise Schuldenrestrukturierungen, die bei Bedarf auch einen Erlass umfassen können.
Die Prinzipien des Common Framework entsprechen weitestgehend denen des Pariser Clubs (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), insbesondere die Durchführung eines IWF (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Programms, Gläubigergleichbehandlung auch unter Einbindung privater Gläubiger und Schuldentransparenz. Dass durch die G20-Initiative China und andere nicht im Pariser Club organisierten Ländern in Restrukturierungen eingebunden werden, ist ein Erfolg.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Impfallianz Gavi ist eine öffentlich-private Partnerschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) mit dem Ziel, Menschen in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) durch Impfungen gegen vermeidbare Krankheiten zu schützen. Dazu unterstützt Gavi unter anderem den Ausbau nationaler Impfprogramme, die Einführung neuer Impfstoffe und die nachhaltige Finanzierung von Impfkampagnen.
Alle wichtigen Entscheidungsträger im Immunisierungsbereich arbeiten dabei partnerschaftlich zusammen: die Regierungen von Industrie- und Entwicklungsländern, die Weltgesundheitsorganisation (WHO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), die Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Impfstoffhersteller, Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens und Nichtregierungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), etwa die Gates-Stiftung. Das BMZ unterstützt die Arbeit der Impfallianz seit 2006.
Das könnte Sie auch interessieren:
Geberländer sind Staaten, die internationale Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) finanzieren. Hierzu gehören die Mitglieder des Entwicklungsausschusses (DAC (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Auch die Europäische Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist Mitglied des Ausschusses und zählt damit zur Geber-Gruppe. Zu den Geberländern außerhalb des DAC gehören Saudi-Arabien, ein Teil der Golfstaaten, einzelne Schwellenländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) wie China, Brasilien und die Türkei sowie einige Mitgliedsländer der Gruppe der 77 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Es gibt Investmentfonds, die darauf spezialisiert sind, gezielt und zu einem möglichst stark reduzierten Preis Staatsanleihen von Ländern zu erwerben, die sich in Zahlungsschwierigkeiten befinden.
Verfügt das Land, etwa nach einem Schuldenerlass durch andere Gläubiger, wieder über größeren finanziellen Handlungsspielraum, klagen die Fonds die Rückzahlung der vollen Summe einschließlich hoher Verzugs- und Strafzinsen ein und erzielen so hohe Renditen.
Der von Kritikern dieser Geschäftspraxis verwendete Name „Geierfonds“ soll darauf hindeuten, dass solche Investoren Interesse an der finanziellen Notlage der verschuldeten Länder haben, um daraus Vorteile zu erzielen.
Schuldenrestrukturierungsverhandlungen wurden von „Geierfonds“ in der Vergangenheit in verschiedenen Fällen boykottiert. Als potenzielle Trittbrettfahrer untergraben sie auch die Kooperationsbereitschaft anderer Gläubiger. Einige Länder haben bereits nationale Gesetze verabschiedet, um diese Praxis zu unterbinden.
Der Gemeinsame Markt Ost- und Südafrikas (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA) ist ein Zusammenschluss afrikanischer Staaten zur Förderung von Handel, Wirtschaft und regionaler Kooperation. Die Aktivitäten des COMESA umfassen unter anderem den Ausbau einer Freihandelszone und einer Zollunion sowie weitere Maßnahmen zur Förderung des regionalen Handels.
Die Mitgliedsstaaten sind (Stand: März 2024): Ägypten, Äthiopien, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Eswatini, Kenia, Komoren, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Ruanda, Sambia, Seychellen, Simbabwe, Somalia, Sudan, Tunesien und Uganda.
Der Gemeinsame Südamerikanische Markt (Mercado Común del Sur, MERCOSUR) ist ein regionaler Zusammenschluss der fünf südamerikanischen Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela. (Die Mitgliedschaft von Venezuela ist seit 2017 suspendiert.) Bolivien, Chile, Ecuador, Guyana, Kolumbien, Peru und Suriname sind assoziierte Mitglieder, Bolivien befindet sich in Beitrittsverhandlungen (Stand: Februar 2024).
Der MERCOSUR wurde 1991 gegründet und hat zum Ziel, durch politische, soziale und wirtschaftliche Zusammenarbeit die regionale Integration zu fördern. Politische Schwerpunkte sind die Stärkung des freien Verkehrs von Dienstleistungen, Produktionsmitteln und Waren, die Ausgestaltung einer gemeinsamen Außenhandels- und Wirtschaftspolitik und die Harmonisierung der Gesetzgebung in den jeweiligen Bereichen. Die Zusammenarbeit innerhalb des MERCOSUR wird schrittweise um kulturelle, soziale und wissenschaftliche Aspekte erweitert.
Die Europäische Union (EU) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der MERCOSUR haben sich im Juni 2019 auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Es ist Teil eines umfassenderen Assoziationsabkommens‚ über das noch verhandelt wird.
Externe Links:
Das Gemeinsame Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS) wurde 1994 ins Leben gerufen, um koordiniert und konzentriert gegen die HIV (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)/Aids (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Pandemie vorzugehen. Es ersetzte das seit 1987 bestehende Global Programme on AIDS (GPA).
Das Programm hat die Aufgabe, weltweit die Bemühungen um die Eindämmung der Pandemie zu steuern, zu stärken und zu stützen. Ziel ist, die Verbreitung von HIV und Aids zu verhindern, die Behandlung und Betreuung der Kranken zu fördern und die gesellschaftlichen und persönlichen Folgen der Pandemie abzufedern. UNAIDS baut dazu Wissensstationen und Netzwerke auf, bündelt Erfahrungen und unterstützt Organisationen und Institutionen auf allen politischen Ebenen.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Thema: Gemeinsam gegen HIV und Aids
Externer Link:
Die englische Sprache unterscheidet das biologische Geschlecht („sex“) vom sozialen Geschlecht („gender“), der gesellschaftlich geprägten und individuell erlernten Geschlechterrolle. Diese Geschlechterrolle wird durch die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Organisation einer Gesellschaft und durch die in ihr geltenden rechtlichen und ethisch-religiösen Normen und Werte bestimmt. Die Rollenzuweisungen können in verschiedenen Gesellschaften und auch innerhalb einer Gesellschaft stark variieren. Im Gegensatz zum biologischen Geschlecht sind die Geschlechterrollen von Frauen und Männern wandelbar.
Entwicklungspolitische Gender-Maßnahmen bauen auf dieser Flexibilität auf. Sie berücksichtigen die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern und die Tatsache, dass es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. Anders als bei einer reinen Frauenförderung werden bei solchen Maßnahmen die Männer in die Strategie einbezogen und für die Ziele der Frauen sensibilisiert.
Gender-Mainstreaming ist ein strategischer Ansatz zur Förderung und Durchsetzung der Gleichstellung aller Geschlechter. Bei politischen und gesellschaftlichen Vorhaben und Entscheidungen werden im Rahmen dieses Ansatzes immer die unterschiedlichen Lebenslagen und Interessen von Frauen, Männern und Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten berücksichtigt (siehe Gender (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Eine ungleiche Behandlung der verschiedenen Geschlechter soll dadurch von vornherein verhindert werden.
Dieses Leitbild der Geschlechtergerechtigkeit basiert auf der Erkenntnis, dass es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt und dass die unterschiedlichen Geschlechter in unterschiedlicher Weise von politischen Entscheidungen und Verwaltungsakten betroffen sein können. Das Leitbild umfasst ausdrücklich alle Lebensbereiche, nicht nur Maßnahmen, die sich gezielt der Gleichstellung widmen (siehe Mainstreaming (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)).
Laut dem Vertrag von Amsterdam ist Gender-Mainstreaming ein offizielles Ziel der Europäischen Union. In der Entwicklungszusammenarbeit erhöht Gender-Mainstreaming nicht nur die Zielgenauigkeit und Wirksamkeit der Vorhaben, sondern auch die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Generaldirektionen sind Verwaltungseinheiten der Europäischen Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die jeweils für einen bestimmten Politikbereich zuständig sind. Aufgabe der Generaldirektionen ist es, Strategien, Rechtsvorschriften und Förderprogramme der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu entwickeln, umzusetzen und zu verwalten. Jeder Generaldirektion steht ein EU-Kommissar vor.
Für die Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der EU ist die Generaldirektion Internationale Partnerschaften (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zuständig.
Die Generaldirektion (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Internationale Partnerschaften ist innerhalb der Europäischen Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) für die Bereiche Entwicklung und internationale Hilfe zuständig. Die europäische Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) konzentriert sich auf zwei Schwerpunkte:
- Stärkung von Menschenrechten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Demokratie (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Good Governance (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Förderung einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Zu den Aufgaben der Generaldirektion Internationale Partnerschaften gehört auch, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten zu vertiefen, um die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit zu erhöhen.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Mit dem Generalised Scheme of Preferences (GSP, deutsch: Allgemeines Präferenzsystem, APS) gewähren Industriestaaten Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)einseitig Handelserleichterungen und tragen damit zu nachhaltiger Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Armutsreduzierung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bei. Das System wurde unter dem Dach der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) entwickelt und seitdem in unterschiedlichen Formen in verschiedenen Industrieländern eingeführt.
Das GSP der Europäischen Union gibt es seit 1971. Es sieht drei Stufen von Zollpräferenzen vor, die sich nach dem Entwicklungsstand des begünstigten Landes richten:
- Das Standard-GSP für Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen. Sie erhalten Zollermäßigungen für zwei Drittel der in die EU eingeführten Waren, sofern sie 15 Kernkonventionen zu Menschen- und Arbeitsrechten einhalten.
- GSP+: eine als Anreiz dienende Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung. GSP+ senkt die entsprechenden Zölle auf null Prozent für Länder, die 27 internationale Konventionen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte Umwelt- und Klimaschutz sowie verantwortungsvolle Staatsführung umsetzen.
- Everything but Arms (EBA, deutsch: Alles außer Waffen): eine Sonderregelung für die am wenigsten entwickelten Länder (LDCs (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), die ihnen zoll- und quotenfreien Zugang zum EU-Markt für alle Produkte außer Waffen und Munition gewährt.
Externer Link:
Für den Schutz von Flüchtlingen bestehen umfassende völkerrechtliche Regelungen.
Das wichtigste Abkommen ist die Genfer Flüchtlingskonvention (Externer Link) von 1951. Sie legt fest, wer ein Flüchtling (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist und welche Rechte und Pflichten er gegenüber dem Aufnahmeland hat. Ein Kernprinzip der Konvention ist das Verbot, einen Flüchtling in ein Land zurückzuweisen, in dem sie oder er Verfolgung fürchten muss. Bestimmte Gruppen – zum Beispiel Kriegsverbrecher – sind vom Flüchtlingsstatus ausgeschlossen.
Die Genfer Flüchtlingskonvention war zunächst darauf beschränkt, hauptsächlich europäische Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg zu schützen. Durch das Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1967 (Externer Link) wurde der Wirkungsbereich der Konvention sowohl zeitlich als auch geographisch erweitert.
Auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 ist der Flüchtlingsschutz verankert. In Artikel 14 ist das Recht auf Asyl (Externer Link) definiert. Dieses kann jedoch nicht eingeklagt werden, weil die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte keinen völkerrechtlich bindenden Status hat.
Außerdem gibt es verschiedene regionale Instrumente zum Schutz von Flüchtlingen.
Das gegenwärtige Ausmaß der Fluchtbewegungen, die ungleiche Verteilung der Flüchtlinge und die damit einhergehende Überlastung von Aufnahmeländern ist eine große Herausforderung für die Umsetzung des völkerrechtlich verbürgten Flüchtlingsschutzes.
siehe Weibliche Genitalverstümmelung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (englisch: Female Genital Mutilation, FGM)
Das in Bonn ansässige German Institute of Development and Sustainability (IDOS) befasst sich mit entwicklungspolitischer Forschung, Politikberatung und Ausbildung. Gesellschafter der Einrichtung sind die Bundesrepublik Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen. Das Institut erstellt unter anderem Gutachten zu entwicklungspolitischen Themen für das BMZ und andere öffentliche Einrichtungen im In- und Ausland.
IDOS wurde 1964 als Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) gegründet. Seit Juni 2022 trägt es den Namen German Institute of Development and Sustainability (IDOS).
- Externer Link: Website des IDOS (Externer Link)
Der Begriff der Geschlechtsidentität beschreibt das subjektive Empfinden eines Menschen, dem männlichen, weiblichen oder einem dritten Geschlecht anzugehören oder zwischen den Geschlechtern zu stehen. Die Geschlechtsidentität kann vom biologischen Geschlecht und von der gesellschaftlich zugewiesenen Geschlechterrolle abweichen.
Siehe auch:
Trotz großer Fortschritte bei der Reduzierung der Kindersterblichkeit sterben jeden Tag Tausende Mädchen und Jungen unter fünf Jahren an Krankheiten, die vermeidbar wären oder geheilt werden könnten. Etwa 800 Mädchen und Frauen sterben täglich an den Folgen von Schwangerschaft und Geburt, weil sie nicht ausreichend medizinisch betreut wurden. Millionen Menschen in den Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) leiden unter HIV (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Aids (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Tuberkulose, Malaria und anderen Tropenkrankheiten, aber auch zunehmend unter nicht übertragbaren Krankheiten wie Herzkreislauferkrankungen, Krebs oder Diabetes. Die Verbesserung ihrer gesundheitlichen Situation ist eine der wichtigsten Aufgaben der internationalen und der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Ausführliche Informationen zum Engagement des BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) im Gesundheitssektor finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Mit der Strategie „Global Gateway“ will die Europäische Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) im Rahmen des Team-Europe-Ansatzes (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) umfangreiche private und öffentliche Investitionen in Gang setzen, um bis 2027 zusammen mit ihren Partnerländern die Entwicklung der globalen Infrastruktur voranzutreiben.
Die Strategie finanziert sich unter anderem aus dem Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI-Global Europe) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und dessen Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung Plus (EFSD+) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Gefördert werden insbesondere die Bereiche
- digitale Vernetzung,
- nachhaltig ausgebaute und krisentaugliche Verkehrsnetze,
- saubere Energie und Klimaschutz,
- globale Gesundheit und verlässliche pharmazeutische Lieferketten,
- Bildung und Forschung.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Inklusion von Mädchen und Frauen und anderen benachteiligten Gruppen.
Die Strategie Global Gateway ist zugleich der Beitrag der EU und ihrer Mitgliedsstaaten zur G7-Partnerschaft für Globale Infrastruktur und Investitionen (PGII).
Weitere Informationen zum Engagement des BMZ für Infrastruktur-Initiativen finden Sie hier.
1993 verabschiedeten die Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) die Pariser Prinzipien (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die den UN-Mitgliedsstaaten die Einrichtung einer nationalen Menschenrechtsinstitution (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) empfehlen. Die Globale Allianz der Nationalen Menschenrechtsinstitutionen (GANHRI) ist der Dachverband dieser nationalen Einrichtungen. Sie interpretiert die Pariser Prinzipien und akkreditiert die einzelnen nationalen Institutionen nach festgelegten Regeln. Die Akkreditierung und Zuerkennung des (höchsten) A-Status ist Voraussetzung für eine aktive Mitwirkung und ein Rederecht in den Gremien der Vereinten Nationen.
Im Juni 2024 gehörten dem Dachverband GANHRI 118 Mitglieder an – 90 mit A-Status und 28 mit B-Status. Das Deutsche Institut für Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verfügt seit seiner Gründung 2001 über den A-Status.
- Externer Link: Website der GANHRI (englisch) (Externer Link)
Die Globale Fazilität zur Verringerung und Bewältigung von Katastrophen (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, GFDRR) wurde auf Initiative der Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gegründet. Als globale Partnerschaft von Geberländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und internationalen Organisationen ist die GFDRR darauf spezialisiert, nach einer Katastrophe Schäden und Verluste zu ermitteln und den Wiederaufbau zu fördern. Sie unterstützt einkommensschwache Entwicklungsländer mithilfe von Fördergeldern, technischer Hilfe und dem Aufbau von Kapazitäten. Außerdem zielt sie darauf ab, alle Weltbank-Programme zunehmend katastrophenpräventiv auszurichten.
Die GFDRR ist auf internationalen Konferenzen zum Thema Katastrophenrisikomanagement sowie zu eng verwandten Themen (etwa Klimawandelanpassung) vertreten und dient zusammen mit dem UNDRR (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) als wichtiger Impulsgeber auf internationaler Ebene.
2018 wurde durch Unterstützung Deutschlands ein Programm ins Leben gerufen, das die Verknüpfung der Bereiche Katastrophenrisikomanagement, Konfliktprävention und Friedensförderung unterstützt, um so die Resilienz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gegenüber Krisen und Katastrophen zu erhöhen.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Verschiedene internationale Agrarforschungszentren schlossen sich 1971 zur Beratungsgruppe für internationale Agrarforschung (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR) zusammen. Heute bezeichnet sich das Netzwerk als globale Forschungspartnerschaft für eine ernährungssichere Zukunft und umfasst 15 Zentren auf fünf Kontinenten. Dazu zählen unter anderem das internationale Reisforschungsinstitut, das Mais- und Weizenforschungsinstitut und Forschungseinrichtungen, die auf Landwirtschaft in Trockengebieten oder tropischen Regionen spezialisiert sind. Die Ergebnisse der Forschungszentren sind allgemein zugänglich und dürfen nicht patentiert werden.
2019 hat die CGIAR einen Umstrukturierungsprozess gestartet, um ihre Wirksamkeit zu steigern und den globalen Herausforderungen Ernährungssicherung, biologische Vielfalt und Anpassung an den Klimawandel besser begegnen zu können.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Globale Partnerschaft für Bildung (Global Partnership for Education, GPE) ist ein Zusammenschluss von Geber- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie internationalen staatlichen und nicht staatlichen Organisationen, Stiftungen und der Privatwirtschaft. Sie strebt an, allen Kindern weltweit den Zugang zu qualitativ hochwertiger und kostenfreier Grundbildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu ermöglichen.
Die GPE besteht seit 2011 in Nachfolge der internationalen Bildungsinitiative Education for All – Fast Track Initiative (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (EFA-FTI).
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Globale Umweltfazilität (Global Environment Facility, GEF) fördert Projekte in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die dem globalen Umweltschutz zugutekommen. Die GEF stellt Mittel für die Bereiche Klimawandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Biodiversität (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Landdegradierung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)/Wüstenbekämpfung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), internationale Gewässer, Chemikalien und Wälder (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zur Verfügung. Die Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) sind für die Durchführung der GEF-Projekte verantwortlich. Darüber hinaus beteiligen sich weitere multilaterale Organisationen, zahlreiche Nichtregierungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie nationale und bilaterale Durchführungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) an der Umsetzung von GEF-Projekten.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Auf der 15. Weltnaturkonferenz in Montreal (Kanada) haben die Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (CBD) eine neue globale Vereinbarung zum Schutz der Natur getroffen: den „Globalen Biodiversitätsrahmen“ (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF).
Wichtigstes Ziel: Bis 2030 soll der Verlust der biologischen Vielfalt gestoppt und der Trend umgekehrt werden. Dafür hat sich die Staatengemeinschaft vier langfristige Ziele bis 2050 gesetzt und 23 Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen. Eines der Hauptziele lautet, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der Land- und der Wasserfläche unter Schutz gestellt werden – unter Wahrung der Rechte Indigener Völker (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und lokaler Gemeinschaften. Außerdem sollen 30 Prozent der geschädigten Ökosysteme an Land und im Meer bis 2030 renaturiert werden.
Auch Finanzierungsziele wurden vereinbart: Für den Schutz der biologischen Vielfalt sollen bis 2025 pro Jahr 20 Milliarden US-Dollar aus Ländern des Globalen Nordens (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in den Globalen Süden fließen, bis 2030 soll dieser Betrag auf 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr steigen. Insgesamt sollen bis 2030 alle Länder gemeinsam 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr in den Schutz der biologischen Vielfalt investieren.
Ausführliche Informationen über entwicklungspolitische Ansätze zum Erhalt der Biodiversität finden Sie hier.
Der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, kurz: The Global Fund) wurde 2001 von der UN-Sondergeneralversammlung zu HIV (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Aids (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ins Leben gerufen, um diese drei und andere übertragbare Krankheiten zurückzudrängen. Der Fonds legt keine eigenen Programme auf, sondern finanziert nationale Maßnahmen gegen die Krankheiten und zur Stärkung der Gesundheitssysteme. Er setzt somit auf die Eigenverantwortung der Regierungen und fördert die Mitwirkung der Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der privaten Wirtschaft.
Nach eigenen Angaben retteten die vom Globalen Fonds geförderten Programme zwischen 2002 und 2023 rund 65 Millionen Menschen das Leben. In den Ländern, in denen der Globale Fonds investierte, ging die Zahl der an Aids, Tuberkulose oder Malaria gestorbenen Menschen demnach um mehr als 60 Prozent zurück.
Deutschland ist derzeit der viertgrößte staatliche Geber des Globalen Fonds. Seit seiner Gründung hat Deutschland dem Fonds 5,1 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt (Stand: November 2024). Für die Jahre 2023 bis 2025 hat Deutschland 1,3 Milliarden Euro zugesagt.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Der Globale Flüchtlingspakt wurde im Dezember 2018 von der UN-Generalversammlung angenommen und soll die internationale Zusammenarbeit beim Flüchtlingsschutz fördern und eine gerechtere Verantwortungsteilung innerhalb der Staatengemeinschaft erreichen.
Ein wichtiges Ziel des Globalen Flüchtlingspakts ist die noch bessere Verzahnung von humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung. So soll eine gut aufeinander abgestimmte und somit nachhaltigere Krisenbewältigung möglich werden, die Flüchtlingen und Aufnahmeländern langfristige Perspektiven eröffnet.
Der Pakt umfasst vier zentrale Ziele:
- den Druck auf die Aufnahmeländer mindern,
- die Eigenständigkeit und Widerstandsfähigkeit von Flüchtlingen fördern,
- den Zugang zu Drittstaatenlösungen verbessern (zum Beispiel durch die Neuansiedlung besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge),
- die Bedingungen fördern, die eine Rückkehr in das Heimatland in Sicherheit und Würde ermöglichen.
Der Pakt besteht aus zwei Teilen, einem umfassenden Rahmenplan für Flüchtlingshilfemaßnahmen (Comprehensive Refugee Response Framework, CRRF), dem die Mitgliedsstaaten durch die New Yorker Erklärung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bereits zugestimmt haben, und einem Aktionsplan.
Zur Umsetzung des Globalen Flüchtlingspakts fand im Dezember 2019 das erste und vom 13. bis 15. Dezember 2023 das zweite Globale Flüchtlingsforum in Genf statt. Das Forum soll als wichtigste Plattform zur Umsetzung des Paktes künftig alle vier Jahre auf Ministerebene tagen.
Das BMZ leistet wichtige Beiträge zur Umsetzung des Flüchtlingspaktes. Vor allem mit der strukturbildenden Übergangshilfe als Instrument der Krisenbewältigung sowie der Sonderinitiative „Geflüchtete und Aufnahmeländer“ stärkt das BMZ die Resilienz von Menschen auf der Flucht und Aufnahmegemeinden gleichermaßen und schafft langfristige Strukturen und Zukunftsperspektiven.
Externer Link:
Der „Globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration“ wurde im Dezember 2018 von der UN-Konferenz in Marrakesch (Marokko) angenommen. Mit dem Pakt wurden erstmals globale Leitlinien für die internationale Migrationspolitik verabredet.
Durch den Pakt soll die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Migration verbessert werden und die Rahmenbedingungen für Migration humaner gestaltet werden. Außerdem sollen die Hauptursachen für irreguläre Migration behoben werden. Der Pakt ist rechtlich nicht bindend, die Souveränität der Staaten bleibt bei der Migrationspolitik erhalten.
Der Migrationspakt enthält 23 Ziele, die sich die Staaten setzen, um die Herausforderungen globaler Migration zu bewältigen.
Dazu gehören unter anderem:
- Lebensbedingungen weltweit so verbessern, dass mehr Menschen in ihrer Heimat bleiben können
- Verbesserung der Verfügbarkeit und Flexibilität der Wege für eine reguläre Migration
- Migranten besser gegen Ausbeutung, Missbrauch und die Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten schützen
- Bessere internationale Koordination von Rettungseinsätzen, um den Tod und die Verletzung von Migranten zu verhindern
- Grenzübergreifende Bekämpfung von Schleuserbanden und Menschenhandel
- Sichere und würdevolle Rückkehr von Migranten ermöglichen
Externe Links:
- Globaler Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (Externer Link)
- UN-Migrationspakt in 60 Sekunden (Externer Link) (Video der Bundesregierung)
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Begriffe „Globaler Süden“ und „Globaler Norden“ lösen zunehmend Bezeichnungen wie Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Schwellenländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und den früher häufig verwendeten Begriff „Dritte Welt“ ab.
Die Bezeichnungen sollen die Situation von Ländern in der globalisierten Welt möglichst wert- und hierarchiefrei beschreiben. In diesem Sinne ist ein Land des Globalen Südens ein politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich benachteiligter Staat. Die Länder des Globalen Nordens befinden sich dagegen in einer privilegierten Position, was Wohlstand, politische Freiheit und wirtschaftliche Entwicklung angeht. Dass es diese Ungleichheiten gibt, hängt auch mit der europäischen Kolonialgeschichte und daraus hervorgegangenen globalen Machtstrukturen zusammen. Sie haben sich über Jahrhunderte verfestigt und zu einseitigen Abhängigkeiten geführt. Die Begriffe „Globaler Süden/Globaler Norden“ sollen das herausstellen und werden deshalb auch immer mehr von Akteurinnen und Akteuren des Globalen Südens selbst verwendet.
Die Bezeichnungen sollen nicht zur Verallgemeinerung der Verhältnisse in allen entsprechenden Ländern dienen, denn die Länder des Globalen Südens sind sehr unterschiedlich. Sie sind zudem nur bedingt geografisch zu verstehen. So werden Australien und Neuseeland dem Globalen Norden zugeordnet, während Länder wie Afghanistan und die Mongolei zum Globalen Süden gezählt werden.
Bei der Verwendung der Begriffe sollte also deutlich gemacht werden, was genau darunter verstanden werden soll, und um welches Thema und welchen Kontext es genau geht.
Als Globalisierung wird die zunehmende wirtschaftliche, politische und kulturelle Verflechtung von Gesellschaften, Staaten und Weltregionen bezeichnet. Ausgangspunkt sind dabei wirtschaftliche Prozesse, zum Beispiel die Internationalisierung der Güter- und Finanzmärkte. Diese Prozesse haben sich durch die Entwicklung der Verkehrs- und Kommunikationstechnik in den vergangenen Jahren beschleunigt. So wächst zum Beispiel der Welthandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) schneller als die Güterproduktion. Auch viele ökologische Probleme wie Klimawandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Desertifikation (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) haben globalen Charakter.
Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Es ist unter anderem für die Pflege der internationalen kulturellen Zusammenarbeit zuständig. Im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit veranstaltet das Goethe-Institut unter anderem Treffen für ehemalige Fortbildungsteilnehmer, damit diese ihre Kontakte aktiv pflegen können.
- Externer Link: Website des Goethe-Instituts (Externer Link)
Wörtlich übersetzt bedeutet der englische Begriff Good Financial Governance „gute finanzielle Steuerung“. Er steht für transparente und leistungsfähige öffentliche Finanzsysteme, die sowohl die Seite der Einnahmen (vor allem Steuerpolitik, Steuererhebung, Schuldenaufnahme, Vermögensbewirtschaftung, Verwaltung internationaler Zuflüsse) als auch die Seite der Ausgaben (Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Beschaffung, Rechnungslegung, Rechnungsprüfung) umfassen.
Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt Deutschland seine Partnerländer dabei, die eigenen Einnahmen zu erhöhen und öffentliche Mittel verantwortungsvoll und entwicklungsorientiert einzusetzen.
Ausführliche Informationen über entwicklungspolitische Ansätze im Bereich Good Financial Governance finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff „gute Staatsführung“ oder auch „gute Regierungsführung“. Gemeint ist die Art und Weise, in der in einem Staat Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden. Good Governance beschränkt sich nicht auf die Regierung, sondern gilt für alle Betroffenen und Beteiligten. Gute Regierungsführung ist verantwortungsvolle Regierungsführung und hat unter anderem folgende Charakteristika: Sie ist transparent und effektiv. Sie legt Rechenschaft ab. Sie beteiligt alle Menschen und berücksichtigt die Meinung von Minderheiten und die Bedürfnisse von Schwachen.
Ausführliche Informationen zum deutschen Engagement für gute Regierungsführung finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Ziel von Grundbildung ist es, grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten für den Alltag und die Arbeitswelt aufzubauen und so die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben und weiteres Lernen zu schaffen. Für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) umfasst die erweiterte Grundbildung folgende Elemente:
- die frühkindliche Bildung (Kindergarten/Vorschule),
- die Primarschulbildung (Grundschule),
- die untere Sekundarschulbildung (bis zum ersten Schulabschluss, der für eine berufliche Ausbildung qualifiziert)
- und die nachholende Grundbildung für Jugendliche und Erwachsene.
In der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) hat die Staatengemeinschaft vereinbart, bis zum Jahr 2030 sicherzustellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen können, die zu brauchbaren und effektiven Lernergebnissen führt.
Doch laut Weltbildungsbericht 2019 der UNESCO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gingen im Jahr 2017 weltweit rund 64 Millionen Kinder im Grundschulalter nicht zur Schule. Etwa 61 Millionen Jugendliche besuchten nach Abschluss der Grundschule keine weiterführende Schule – eine erhebliche Einschränkung ihrer persönlichen und gesellschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten.
Deutschland unterstützt seine Partnerländer dabei, den Zugang zu Grundbildung – insbesondere für Mädchen – zu erweitern, die Qualität des Unterrichts zu verbessern und außerschulische Bildungsaktivitäten zu fördern.
Ausführliche Informationen zu den BMZ-Aktivitäten im Bereich Grundbildung finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die sogenannten „Grünen Innovationszentren in der Agrar- und Ernährungswirtschaft“ wurden im Rahmen der BMZ-Sonderinitiative „Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“ ins Leben gerufen. In 15 Partnerländern tragen die Zentren dazu bei, Konzepte für die Verbesserung der regionalen Versorgung mit Nahrungsmitteln zu entwickeln, das Einkommen von kleinbäuerlichen Betrieben zu steigern und Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich, beispielsweise in der Lebensmittelverarbeitung zu schaffen.
Die Zentren bieten den Bäuerinnen und Bauern Beratung und Ausbildung, eröffnen ihnen Zugang zu Finanzdienstleistungen und fördern die Verbreitung technischer Neuerungen in der Landwirtschaft. Außerdem unterstützen sie die Landwirte bei der Gründung von Erzeugergemeinschaften und Interessenverbänden.
Mehr zum Thema finden Sie hier.
Als „grün“ wird Wasserstoff bezeichnet, der klimaneutral gewonnen wurde. Dazu wird – unter Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energiequellen – Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der freigesetzte Wasserstoff wird aufgefangen und ist vielseitig einsetzbar: Das Gas dient dazu, Energie zu speichern und zu transportieren. In der Industrie lässt sich grüner Wasserstoff zum Beispiel anstelle von Kohle und Erdöl einsetzen, über Brennstoffzellen kann er Strom und Wärme für Gebäude liefern.
Durch Zugabe von Kohlenstoffdioxid (CO₂) kann grüner Wasserstoff in klimaneutrales Brenngas (Power-to-Gas) oder in synthetischen Kraftstoff (Power-to-Liquid) für Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge umgewandelt werden. Derartige Folgeprodukte werden unter dem Begriff „Power-to-X“ (PtX) zusammengefasst.
Grüner Wasserstoff gilt als Treibstoff der Zukunft und als unverzichtbarer Baustein für das Erreichen der Klimaziele des Pariser Abkommens (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Die Technologie ist noch in der Entwicklung. Für die Herstellung und Verarbeitung werden große Mengen an erneuerbarer Energie benötigt.
Mehr zum Engagement des BMZ für grünen Wasserstoff finden Sie hier.
Die Gruppe der 7 (G7) ist – wie die G20 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) – keine internationale Organisation, sondern ein informelles Forum von Staats- und Regierungschefs.
Die Gruppe wurde 1975 von den damals bedeutendsten Industrienationen gegründet: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika; Kanada kam 1976 dazu. Die Europäische Union hat einen Beobachterstatus.
1998 wurde die Gruppe durch die Aufnahme von Russland zur G8. Aufgrund der Verletzung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit der Ukraine durch Russland sagten die übrigen G8-Mitglieder ihre Teilnahme am ursprünglich in Sotschi geplanten G8-Gipfel 2014 ab und beschlossen, sich bis auf Weiteres wieder im G7-Format ohne Russland zu treffen.
Die Mitglieder kommen mindestens einmal im Jahr zu einem Gipfeltreffen zusammen. Dort diskutieren sie Schlüsselfragen der Weltpolitik, tauschen ihre Standpunkte aus und entwickeln gemeinsam konstruktive Lösungen und entwicklungspolitische Initiativen. Der Vorsitz innerhalb der Gruppe wechselt jährlich unter den Mitgliedern. 2022 hatte Deutschland die Präsidentschaft inne.
Die Länder der G7 stellen etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung und erwirtschaften mehr als 40 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Sie gehören zu den größten Beitragszahlern in internationalen Organisationen und finanzieren rund 75 Prozent der von der OECD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) erfassten weltweiten öffentlichen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit (ODA (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)).
Die Entscheidungsfindung innerhalb der G7 findet im Konsens statt. Auch wenn ihre Beschlüsse und Selbstverpflichtungen keine rechtliche Bindung haben, ist ihre weltweite Wirkung nicht zu unterschätzen. Umgesetzt werden sie über bilaterale (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Maßnahmen der G7-Staaten und über deren großen Einfluss in vielen multilateralen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Organisationen.
Informationen über die deutsche G7-Präsidentschaft 2022 finden Sie hier.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Gruppe der 20 (G20), das sind die 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, die Türkei und die USA) sowie die Europäische Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und seit 2023 auch die Afrikanische Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Die Mitglieder der G20 repräsentieren 80 Prozent der Weltbevölkerung, erwirtschaften 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und sind für 85 Prozent aller CO₂-Emissionen verantwortlich. Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 wurde die G20 von einem Format auf Ebene der Finanzministerinnen und -minister, als das sie seit 1999 bestand, um die Ebene der Staats- und Regierungschefinnen und -chefs erweitert.
Im Jahr 2010 wurde eine G20-Arbeitsgruppe für entwicklungspolitische Themen (Development Working Group) eingerichtet sowie eine G20-Entwicklungsagenda mit einem mehrjährigen Aktionsplan verabschiedet, dem „Seoul Development Consensus for Shared Growth“.
Seither ist Entwicklungspolitik als eigenständiges Thema fest im G20-Prozess verankert. Unter der chinesischen G20-Präsidentschaft 2016 erklärten die G20-Staaten ihre Absicht, ihre Arbeit an den Zielen der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auszurichten und verabschiedeten den G20-Aktionsplan zur Umsetzung der Agenda 2030. Der Aktionsplan wurde unter anderem unter deutscher G20-Präsidentschaft 2017 weiterentwickelt und ergänzt (Hamburg Update).
Ein eigenständiges Treffen der G20-Entwicklungsministerinnen und -minister fand erstmals 2021 in Matera unter italienischem Vorsitz statt. Seither trafen sich die G20-Entwicklungsministerinnen und -minister regelmäßig unter jeder Präsidentschaft.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Gruppe der 77 (G77) ist der größte Zusammenschluss von Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) innerhalb der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie existiert seit der ersten Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), die 1964 in Genf stattfand. Damals zählte die Gruppe 77 Mitglieder, heute gehören ihr 134 Länder an. Ziel der Gruppe ist es, die gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder international zu vertreten und sich für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung einzusetzen. Die G77 fördert außerdem die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Entwicklungsländer untereinander.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) wurde 1967 gegründet. Sie steht der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU) nahe und ist nach dem früheren bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Hanns Seidel benannt. Die Stiftung sieht ihre Aufgabe darin, politische Zusammenhänge zu analysieren, Demokratie (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Frieden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu fördern, wissenschaftliche Grundlagen für politisches Handeln zu erarbeiten und Menschen auf nationaler und internationaler Ebene zu motivieren und zu befähigen, sich aktiv in die Gestaltung ihrer Gesellschaften einzubringen.
Ziel ihrer auf christlich-sozialen Werten basierenden entwicklungspolitischen Arbeit ist die Förderung menschenwürdiger Lebensverhältnisse in der Welt, um damit einen Beitrag zur Überwindung der Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu leisten. Die Stiftung engagiert sich in rund 60 Ländern für gute Regierungsführung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Demokratie, Rechtsstaatlichkeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Dezentralisierung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
- Externer Link: Website der Hanns-Seidel-Stiftung (Externer Link)
Die Heinrich-Böll-Stiftung ist nach dem Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll benannt und steht der Partei Bündnis 90/Die Grünen nahe. Vorrangige Aufgabe der Stiftung ist die politische Bildung im In- und Ausland zur Förderung der demokratischen Willensbildung, des gesellschaftspolitischen Engagements und der Völkerverständigung. Sie arbeitet mit mehr als 100 Partnerprojekten in 60 Ländern zusammen. Insbesondere fördert die Stiftung Rechtsstaatlichkeit und gerechte Verhältnisse zwischen allen Geschlechtern, die Gleichberechtigung kultureller und ethnischer Minderheiten und die soziale wie politische Partizipation von Migrantinnen und Migranten. Die Grundwerte der Stiftung sind Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie, Solidarität und Gewaltfreiheit.
- Externer Link: Website der Heinrich-Böll-Stiftung (Externer Link)
1996 beschlossen die Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der Internationale Währungsfonds (IWF) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) auf Betreiben der G7 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Staaten eine Initiative zur Entschuldung hoch verschuldeter armer Länder („heavily indebted poor countries“, HIPC). Sie ermöglichte erstmals ein koordiniertes Vorgehen bei der Gewährung von Schuldenerleichterungen. Inzwischen ist die Entschuldungsinitiative nahezu abgeschlossen: Insgesamt haben sich 39 hoch verschuldete Länder für eine Teilnahme an der HIPC-Initiative qualifiziert. 36 von ihnen wurden bereits umfassend entschuldet (Stand: Januar 2023).
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Abkürzung HIV steht für „humanes Immunschwäche-Virus“ (englisch: Human Immunodeficiency Virus). Eine Ansteckung mit dem HI-Virus führt – wenn keine Behandlung mit Medikamenten erfolgt, die die Virusvermehrung hemmen – nach einer meist mehrjährigen Inkubationszeit zur fortschreitenden Zerstörung des Immunsystems (Aids (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)).
Ausführliche Informationen über HIV und Aids und über das deutsche entwicklungspolitische Engagement für die Bekämpfung der Aids-Pandemie finden Sie hier.
Wissenschaft und Forschung sind für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung eines Landes unverzichtbar. Viele ärmere Länder können das international verfügbare Wissen jedoch nicht nutzen. Im Rahmen seiner Entwicklungspolitik fördert Deutschland die Aus- und Weiterbildung von akademischen Fachkräften in besonders entwicklungsrelevanten Forschungszweigen wie Natur- und Agrarwissenschaften, Umweltschutz, Ingenieurs-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
Das könnte Sie auch interessieren:
Durch den Vertrag von Lissabon wurde das Amt des Hohen Vertreters/der Hohen Vertreterin der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) für Außen- und Sicherheitspolitik geschaffen (umgangssprachlich: EU-Außenministerin oder -Außenminister). Durch diese Institution soll das auswärtige Handeln der EU an Wirksamkeit und Kohärenz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gewinnen. Seit Dezember 2024 übt die Estin Kaja Kallas dieses Amt aus.
Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik ist auch Vizepräsidentin der EU-Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und vertritt die EU im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Er führt im Namen der Union den politischen Dialog mit Drittländern und vertritt den Standpunkt der Union in internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen.
Im Rat für Auswärtige Angelegenheiten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) führt sie den Vorsitz. Sie trägt durch ihre Vorschläge zur Festlegung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei und stellt sicher, dass die vom Europäischen Rat (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) erlassenen Beschlüsse umgesetzt werden.
Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wird die Hohe Vertreterin durch den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) unterstützt. Als eine vom Rat und von der Kommission unabhängige Institution ergänzt er die diplomatischen Dienste der Mitgliedsstaaten.
Externer Link:
Laut Definition der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) hungert ein Mensch, wenn er weniger zu essen hat, als er täglich braucht, um sein Körpergewicht zu erhalten und zugleich leichte Arbeit zu verrichten. Im Jahr 2023 litten nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) zwischen 713 und 757 Millionen Menschen unter Hunger. Deutschland engagiert sich in enger Zusammenarbeit mit anderen Gebern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) intensiv im Kampf gegen Hunger und Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Die Sicherung der Ernährung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und die Förderung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) – bei gleichzeitigem Schutz der natürlichen Ressourcen – sind wichtige Ziele der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Ausführliche Informationen über das deutsche Engagement im Kampf gegen den Hunger finden Sie hier.
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) veröffentlicht jährlich einen Bericht über die menschliche Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Der darin enthaltene Index der menschlichen Entwicklung (englisch: Human Development Index, HDI) erfasst die durchschnittlichen Werte eines Landes in grundlegenden Bereichen der menschlichen Entwicklung. Dazu gehören zum Beispiel die Lebenserwartung bei der Geburt, das Bildungsniveau sowie das Pro-Kopf-Einkommen. Aus einer großen Zahl solcher Einzelindikatoren wird eine Rangliste errechnet. Sie ermöglicht es, den Stand der durchschnittlichen Entwicklung eines Landes abzuleiten.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
- Stichwort: Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Das Wort „indigen“ geht auf die lateinische Sprache zurück und bedeutet fachsprachlich „in einem bestimmten Gebiet geboren“ oder „in einem bestimmten Gebiet beheimatet“. Für den zusammengesetzten Begriff „Indigene Völker“ gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Die Vereinten Nationen haben Kriterien formuliert, die sich insbesondere auf die Selbstidentifikation beziehen. Demnach sind Indigene Völker
- Nachfahren der Erstbewohnerinnen und -bewohner eines Gebietes, auch „autochthone Völker“ genannt;
- Völker, die eine kulturelle Besonderheit bewahren wollen, die sich von der nationalen Gesellschaft unterscheidet;
- Völker, die sich selbst als eigene, indigene und somit abgegrenzte Gruppe in der Gesellschaft identifizieren;
- Völker, die die Erfahrung von Unterdrückung, Diskriminierung, Marginalisierung und Enteignung bis hin zur Ausrottung gemacht haben.
In etwa 90 Staaten der Welt leben rund 5.000 Indigene Völker, denen insgesamt mehr als 476 Millionen Menschen angehören. Trotz international verbriefter kollektiver Rechte werden Indigene Völker in den meisten Staaten vom politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben weitgehend ausgeschlossen.
Informationen über das deutsche Engagement für die Rechte Indigener Völker finden Sie hier.
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) wie Internet und Mobilfunk erleichtern die Kommunikation im Alltag, machen Wissen zugänglich, eröffnen neue Austauschmöglichkeiten, ermöglichen die Erschließung neuer Märkte und erleichtern die Datenverwaltung. IKT sind auch für die Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) unverzichtbare Werkzeuge für die Projektplanung und Koordination.
Trotz der schnellen technischen Entwicklung gibt es weltweit noch viele Menschen, die von diesen Techniken und den damit verbundenen Möglichkeiten abgeschnitten sind. Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) will diesem Defizit entgegenwirken und die Chancen des digitalen Wandels für alle nutzbar machen. Daher setzt es sich dafür ein, den Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien zu verbessern und die Nutzung von IKT in allen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern.
Der informelle Sektor ist der Teil einer Volkswirtschaft, dessen wirtschaftliche Tätigkeit nicht staatlich erfasst, reguliert und kontrolliert wird. Nach Schätzungen der OECD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der ILO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) arbeiten mehr als 60 Prozent der Beschäftigten weltweit im informellen Sektor. In Entwicklungs- und Schwellenländern beträgt der Anteil 70 Prozent. Formelle Arbeitsplätze sind dort häufig nur im öffentlichen Dienst, in der gering ausgebauten Industrie und in internationalen Großunternehmen zu finden.
Beispiele für Tätigkeiten im informellen Sektor sind der Direktverkauf von Produkten aus eigener Herstellung, Transportdienstleistungen, kleine Handwerksarbeiten, Tagelöhnerjobs und Kinderarbeit. In der Landwirtschaft sind mehr als 90 Prozent der Beschäftigten informell tätig.
Kennzeichen des informellen Sektors
- kleine Betriebsgrößen (meist Einzel- oder Familienunternehmen)
- keine rechtliche Absicherung (Arbeitsvertrag, Arbeitsschutz, Kündigungsschutz, Mindestlohn, Urlaubsanspruch, Mutterschutz, Recht auf Fort- und Weiterbildung)
- keine soziale Absicherung (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, Unfallversicherung)
- arbeitsintensive Produktion, Verwendung einheimischer Ressourcen und einfacher Techniken
- schlechte Bezahlung, oft menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
- geringe Qualifikation
- kaum gewerkschaftlich organisiert
Da die Beschäftigten im informellen Sektor weder direkte Steuern noch Sozialabgaben zahlen, entgehen dem Staat wichtige Einnahmen. Andererseits bringt der informelle Sektor viel unternehmerische Initiative und Kreativität hervor. Informelle Kleinbetriebe bilden mehr Arbeitskräfte aus als das formale Bildungssystem und produzieren Güter und Dienstleistungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen.
Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) benötigen finanzielle Unterstützung, um die international vereinbarten Entwicklungsziele zu erreichen. Um langfristig stabile und für die Entwicklungsländer berechenbare Zahlungsströme gewährleisten zu können, sind innovative Finanzierungsinstrumente erforderlich, die möglichst unabhängig von der jeweiligen Haushaltssituation der Geberländer sind. Zurzeit konzentriert sich die internationale Diskussion über die Einführung solcher Modelle vor allem auf folgende Finanzierungsinstrumente: Versteigerung von Emissionszertifikaten, Mobilisierung privater Investoren, Internationale Finanzfazilität für Impfprogramme (IFFIm), Abnahmegarantien für Impfstoffe (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Besteuerung von internationalen Finanztransaktionen und eine Flugticketabgabe.
Das Instrument für Heranführungshilfe (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) ist ein entwicklungspolitisches Finanzierungsprogramm der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Die EU unterstützt damit Beitrittskandidaten (Türkei, Albanien, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien) und potenzielle Bewerberländer (Bosnien und Herzegowina, Kosovo) bei der Einführung von EU-Standards in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Das IPA setzt sich aus fünf Komponenten zusammen: Aufbau von Institutionen und Demokratisierung, grenzübergreifende Zusammenarbeit, regionale Entwicklung, Entwicklung der Humanressourcen und Kampf gegen Diskriminierung sowie ländliche Entwicklung.
Externer Link:
Das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, NDICI – Global Europe ) wurde 2021 von der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) geschaffen. Es vereint die bis dahin stark verästelten Finanzierungsprogramme der EU wie zum Beispiel das Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI) oder den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Insgesamt wurde es mit 79,5 Milliarden Euro für den Zeitraum bis 2027 ausgestattet. Mit dem Instrument verfolgt die EU folgende Ziele:
- zur Bekämpfung und auf längere Sicht zur Beseitigung der Armut beitragen
- Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte stärken
- nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und die Bekämpfung des Klimawandels fördern
- irreguläre Migration und Zwangsvertreibung einschließlich ihrer Ursachen bekämpfen
- Multilateralismus (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) fördern und zur Erreichung internationaler Verpflichtungen beitragen, insbesondere der Ziele der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und des Pariser Klimaabkommens (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- stärkere Partnerschaften mit Partnerländern, einschließlich der Europäischen Nachbarschaft, auf der Grundlage gegenseitiger Interessen und Eigenverantwortung fördern
Zu diesen Zwecken ist das Instrument auf drei Säulen aufgebaut:
- die geografische Säule fördert die Beziehungen zu den Partnerländern
- die thematische Säule fördert Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung auf globaler Ebene
- die Krisenreaktionssäule dient Maßnahmen zur Krisenbewältigung, Konfliktverhütung und Friedensförderung
Eine finanzielle Reserve soll eine schnelle Reaktion auf neue Herausforderungen ermöglichen und dient in solchen Fällen der finanziellen Aufstockung der oben genannten Säulen.
Externer Link:
Der Ansatz der integrierten Sicherheit vereint alle Themen und Instrumente, die für den Schutz und die Sicherheit von Staat und Gesellschaft von Bedeutung sind.
Sicherheit ist somit Bestandteil und Ziel aller Politikbereiche: Jeder Bereich ist von einer verschlechterten Sicherheitslage betroffen, jeder kann zur Verbesserung der Sicherheit beitragen.
Integrierte Sicherheit geht über die bloße Vernetzung zwischen den verschiedenen Bundesministerien hinaus. Die unterschiedlichen Politikfelder werden gezielt miteinander verschränkt, um komplexe Bedrohungen zu identifizieren und die jeweils passenden Instrumente zu entwickeln, um darauf angemessen zu reagieren – vorbeugend, eingreifend und nachsorgend. Die Entwicklungspolitik ist dabei immer Teil eines abgestimmten Gesamtengagements der Bundesregierung.
Die Wechselwirkungen zwischen innerer und äußerer Sicherheit führen dazu, dass der Schutz eines Staates nach außen nur funktioniert, wenn er auch im Inneren gefestigt ist. Hinzu kommen globale Risiken sowie mittel- und langfristige Herausforderungen für Frieden und Sicherheit, die sich auf nationaler Ebene allein nicht bewältigen lassen. Die Stärkung der Resilienz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sind daher zentrale Elemente der integrierten Sicherheit.
Die deutsche Politik der integrierten Sicherheit soll gemeinsam mit internationalen Partnern noch stärker als bisher zur Sicherheit in Europa und der Welt beitragen.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Thema: Nationale Sicherheitsstrategie
- Thema: Frieden
Das international vereinbarte Leitbild des Integrierten Wasserressourcen-Managements (IWRM) betrachtet die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und das Ökosystem jeweils ganzheitlich und gleichberechtigt. Das Konzept berücksichtigt sämtliche – oft auch überregionale – Nutzungsinteressen und Aktivitäten, die sich auf die Wasserhaushalte auswirken können. Dabei werden die Ansprüche und Perspektiven aller Nutzergruppen in einem Wassereinzugsgebiet betrachtet, um einen fairen Interessenausgleich zu erreichen.
Wichtige Ziele des IWRM sind, Wasserressourcen nachhaltig zu nutzen, Konflikte um Wasser friedlich zu lösen, Armen bezahlbaren Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen und Krankheiten einzudämmen, die durch unsauberes Wasser hervorgerufen werden.
Ausführliche Informationen über Integriertes Wasserressourcen-Management finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Thema: Wasser
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) ist die größte multilaterale Finanzinstitution zur Entwicklungsfinanzierung in Lateinamerika und der Karibik. Sie wurde 1959 mit dem Ziel gegründet, Armut und Ungleichheit in der Region zu bekämpfen sowie eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern. Mit 48 Mitgliedstaaten, darunter 26 regionale und 22 nicht-regionale Mitglieder, ist die IDB ein zentraler Akteur in der Entwicklungsfinanzierung der Region. Sie hat ihren Hauptsitz in Washington D.C., USA.
Die IDB-Gruppe besteht aus der Bank (IDB), dem Privatsektorarm IDB Invest und dem IDB Lab. Seit 2015 wird das Privatsektorgeschäft durch IDB Invest geführt, mit dem Ziel, Unternehmen und Beschäftigung zu stärken sowie Synergien zwischen öffentlichen und privaten Aktivitäten zu schaffen.
Deutschland ist seit 1979 nicht-regionaler Anteilseigner und hält 1,9 Prozent der Stimmrechtsanteile.
Ausführliche Informationen über die Interamerikanische Entwicklungsbank finden Sie hier (Externer Link).
Zum amerikanischen Menschenrechtssystem gehören die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte und der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (Corte Interamericana de Derechos Humanos) mit Sitz in San José, Costa Rica. Beide Institutionen nahmen 1979 ihre Arbeit auf. Sie überwachen die Einhaltung der interamerikanischen Menschenrechtsverträge, insbesondere der Amerikanischen Konvention über Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Bislang haben nur lateinamerikanische Staaten diese Konvention ratifiziert und die Zuständigkeit des Gerichtshofs für Individualbeschwerden anerkannt.
Externer Link:
Der Zwischenstaatliche Sachverständigenrat für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ist ein wissenschaftliches Gremium, das aktuelle Informationen der weltweiten Klimaforschung sammelt und bewertet. Der IPCC präsentiert regelmäßig in Berichten und Stellungnahmen seine Einschätzungen zu den Folgen des Klimawandels (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft sowie Strategien zur Reaktion darauf. Seine Arbeiten dienen auch als Grundlage für die internationalen Klimaverhandlungen.
Der IPCC wurde 1988 von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) ins Leben gerufen. Er steht allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zur Mitwirkung und als Beratungsgremium offen.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
- Thema: Klimawandel und Entwicklung
Entwicklungsorientierte Agrarforschung hat für die Ernährungssicherung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), den Ressourcenschutz und die Anpassung an den Klimawandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) eine herausragende Bedeutung. Sie trägt maßgeblich dazu bei, die Erträge wichtiger Kulturpflanzen zu steigern, angepasste Verfahren im Umgang mit Wasser und Boden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu entwickeln, geeignete Anbaumethoden für Standorte mit ungünstigen naturräumlichen Bedingungen zu erproben und eine wirtschaftlich effiziente Agrarvermarktung zur Steigerung ländlicher Einkommen zu unterstützen. Darüber hinaus leistet die Agrarforschung einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Agrobiodiversität (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), indem sie Genbanken aufbaut und pflegt und damit den Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) einen kostenlosen Zugang zu genetischen Ressourcen verschafft.
Über bilaterale Kooperationsverträge fördert das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) die Arbeit von internationalen Agrarforschungszentren. Zudem werden deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, insbesondere Nachwuchskräfte, mit verschiedenen Förderprogrammen dabei unterstützt, an internationalen Forschungseinrichtungen zu arbeiten.
Ausführliche Informationen über das deutsche Engagement im Bereich der internationalen Agrarforschung finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) ist die älteste Sonderorganisation der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie wurde 1919 gegründet. Als einzige UN-Organisation setzt sie sich nicht ausschließlich aus Staaten zusammen. Neben den Regierungen der Mitgliedsstaaten gehören ihr auch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen an.
Zu den wesentlichen Aufgaben der ILO gehören die Normensetzung, die Überwachung der Einhaltung der ILO-Normen in den Mitgliedsstaaten, die technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern sowie die Verbreitung von Informationen und Forschungsergebnissen. Seit ihrer Gründung werden von der ILO internationale Arbeitsstandards in Form von Übereinkommen und Empfehlungen ausgearbeitet und auf den internationalen Arbeitskonferenzen verabschiedet.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
- Stichwort: Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (ILO-Konvention 138) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Stichwort: Übereinkommen über indigene Völker (ILO-Konvention 169) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Stichwort: Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (ILO-Konvention 182) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Stichwort: Sozialstandards (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) wurde 1944 auf der Konferenz von Bretton Woods (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) als Teil der Weltbankgruppe (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gegründet. Eine der Hauptaufgaben der IBRD ist es, die wirtschaftliche Entwicklung in Ländern mit mittlerem Einkommen und in kreditwürdigen armen Ländern zu fördern. Dazu vergibt sie Kredite zu marktähnlichen Konditionen.
Deutschland gehört der IBRD seit 1952 an.
Die für die ärmsten Länder der Welt zuständige Internationale Entwicklungsorganisation (International Development Association, IDA) ist Teil der Weltbankgruppe (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und spielt eine Schlüsselrolle bei der weltweiten Armutsbekämpfung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie ist in rechtlicher und finanzieller Hinsicht selbstständig, wird jedoch vom Personal der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) verwaltet. Die IDA verfolgt die gleiche Zielsetzung wie die IBRD, gewährt ihre Kredite jedoch zu weitaus günstigeren Bedingungen und vergibt außerdem Zuschüsse.
Deutschland gehört zu den wichtigsten Gebern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Internationalen Entwicklungsorganisation.
- Externer Link: Website der IDA (englisch) (Externer Link)
Die Internationale Finanz-Corporation (International Finance Corporation, IFC) ist Teil der Weltbankgruppe (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie hat die Aufgabe, die Privatwirtschaft in Entwicklungs- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Schwellenländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu fördern. Dazu bietet sie Kredite, Eigenkapitalbeteiligungen, Garantien und eine Reihe innovativer Finanzierungsprodukte zu kommerziellen Bedingungen an. Ergänzend berät die IFC Regierungen und Firmen zu Fragen der Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung. Die IFC nimmt international eine Führungsrolle bei der Erarbeitung und Umsetzung von Sozial- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Umweltstandards (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ein.
Deutschland ist Gründungsmitglied der Internationalen Finanz-Corporation.
- Externer Link: Website der IFC (englisch) (Externer Link)
Die Internationale Föderation geplanter Elternschaft (International Planned Parenthood Federation, IPPF) ist ein weltweiter Dachverband von unabhängigen Mitgliedsorganisationen, die sich in mehr als 140 Ländern für die Verbesserung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die Durchsetzung und Verankerung der zugrunde liegenden Rechte und für die Verbesserung des Zugangs zu entsprechenden Diensten vor allem für arme, benachteiligte und unterversorgte Bevölkerungsgruppen einsetzen.
- Externer Link: Website der IPPF (englisch) (Externer Link)
InWEnt, die Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH, gibt es seit 1. Januar 2011 nicht mehr. Sie ist – gemeinsam mit dem Deutschen Entwicklungsdienst (DED (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) – in der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) aufgegangen.
InWEnt war eine Organisation für Personalentwicklung, Weiterbildung und Dialog. Sie entstand 2002 durch die Fusion der Carl-Duisberg-Gesellschaft (CDG) und der Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung (DSE).
Der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) ist eine Internationale Finanzinstitution und Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Rom. Gegründet 1977 mit Deutschland als Gründungsmitglied, ist IFADs Kernmandat die Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zur Ernährungssicherung und Armutsbekämpfung in ländlichen Gebieten.
Dabei ergänzt IFAD die Arbeit Multilateraler Entwicklungsbanken und VN-Organisationen durch seinen Fokus auf nachhaltige Strukturveränderungen und einen unternehmerischen Ansatz zur Stärkung von Kleinbauern insbesondere dort, wo andere Internationale Finanzinstitutionen kaum aktiv sind.
Die Finanzierung des IFAD erfolgt über Wiederauffüllungen, die alle drei Jahre stattfinden. Im Durchschnitt tragen über 100 Länder zu jeder Wiederauffüllung des Fonds bei. Deutschland gehört zu den größten Beitragszahlern und unterstützt IFAD über Kernbeiträge und strategische Schwerpunktprogramme, insbesondere in den Bereichen Privatsektor-Investitionen, Klimaanpassung, Beschäftigung für Jugendliche, Gleichstellung und wirtschaftliche Stärkung von Frauen.
Ausführliche Informationen zum Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung finden Sie hier (Externer Link).
Der 1946 geschaffene Internationale Gerichtshof (IGH) hat seinen Sitz in Den Haag (Niederlande). Er ist das wichtigste Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Vor dem Internationalen Gerichtshof werden zwischenstaatliche Streitigkeiten verhandelt – sofern sich alle beteiligten Staaten der Gerichtsbarkeit des IGH unterwerfen. Außerdem erstellt der Gerichtshof Rechtsgutachten zu völkerrechtlichen Fragen für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen.
Der IGH besteht aus 15 Richterinnen und Richtern, die aus verschiedenen Ländern kommen. Alle drei Jahre wird ein Drittel der Mitglieder von der Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und dem Sicherheitsrat (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen neu gewählt, die Amtszeit der Richterinnen und Richter beträgt neun Jahre.
- Externer Link: Internationaler Gerichtshof (englisch) (Externer Link)
Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) wurde 1966 gemeinsam mit dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) von der Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen verabschiedet und trat 1976 in Kraft. Der Zivilpakt garantiert Schutz- und Freiheitsrechte, darunter die Rechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf Schutz vor Folter, Sklaverei sowie staatlicher Willkür, die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Rechte auf Gedanken-, Religions- und Weltanschauungs-, Meinungsäußerungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Der Pakt schützt die Rechte von Minderheiten und formuliert ein allgemeines Diskriminierungsverbot.
Als Kontrollorgan überwacht der UN-Zivilpaktausschuss (Externer Link) die Einhaltung des Pakts. Alle Staaten, die den Zivilpakt ratifiziert haben, müssen dem Ausschuss regelmäßig berichten, wie sie den Pakt umsetzen.
Zusatzprotokolle
Ergänzt wird der Zivilpakt durch zwei Zusatzprotokolle. Das erste sieht die Möglichkeit der Individualbeschwerde vor: Personen, die ihre bürgerlichen und politischen Rechte als verletzt ansehen und den nationalen Rechtsweg erfolglos durchlaufen haben, können Beschwerde beim UN-Zivilpaktausschuss einlegen. Im zweiten Zusatzprotokoll haben sich die Staaten zur Abschaffung der Todesstrafe verpflichtet.
Der Zivilpakt wurde von 174 Staaten ratifiziert, das erste Zusatzprotokoll von 116, das zweite von 91 Staaten (Stand: September 2024). Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik ratifizierten den Pakt 1973. Deutschland hat das erste Zusatzprotokoll 1993 und das zweite Zusatzprotokoll 1992 ratifiziert.
Externe Links:
- Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 1966 (PDF 79 KB) (Externer Link)
- Erstes Zusatzprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 1966 (PDF 42 KB) (Externer Link)
- Zweites Zusatzprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe, 1989 (PDF 33 KB) (Externer Link)
Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt) wurde 1966 gemeinsam mit dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) von der Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen verabschiedet.
Der Sozialpakt enthält
- wirtschaftliche Rechte,
etwa das Recht, einer Einkommen schaffenden Tätigkeit nachzugehen (Recht auf Arbeit), das Recht auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, die Gewerkschaftsfreiheit und das Streikrecht, - soziale Rechte
wie den Schutz der Familie, das Recht auf soziale Sicherheit und das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard (Unterkunft, Nahrung, Gesundheit, Wasser- und Sanitärversorgung) sowie - kulturelle Rechte
wie das Recht auf Bildung, das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben und auf Schutz des geistigen Eigentums.
Der Sozialpakt legt eine stufenweise Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte fest: Vertragsstaaten müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Rechte fortschreitend für alle zu verwirklichen. Als Kontrollorgan überwacht der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR (Externer Link)) die Einhaltung des Pakts. Alle Staaten, die den Sozialpakt ratifiziert haben, müssen dem Ausschuss regelmäßig berichten, wie sie ihn umsetzen.
Zusatzprotokoll
2008 verabschiedete die UN-Generalversammlung ein Zusatzprotokoll zum Sozialpakt, das seit 2013 in Kraft ist. Das Protokoll sieht die Möglichkeit der Individualbeschwerde vor: Personen, die ihre wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Rechte als verletzt ansehen und den nationalen Rechtsweg ausgeschöpft haben, können Beschwerde beim UN-Sozialpaktausschuss einlegen.
Der Sozialpakt wurde von 172 Staaten ratifiziert, das Zusatzprotokoll von 29 Staaten. Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik haben den Sozialpakt 1973 ratifiziert. Dem Zusatzprotokoll ist Deutschland 2023 beigetreten (Stand: September 2024).
Externe Links:
Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) im niederländischen Den Haag ist seit 2003 für die Verfolgung besonders schwerer Straftaten wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression zuständig. Der IStGH soll dazu beitragen, das humanitäre Völkerrecht und das internationale Völkerstrafrecht wirksamer durchzusetzen und gravierende Lücken bei der Strafverfolgung zu schließen.
Das Mandat des IStGH erlaubt es nur, die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Individuen festzustellen, nicht von Staaten. Der Gerichtshof wird nur dann tätig, wenn die nationalen Strafverfolgungsbehörden nicht willens oder nicht in der Lage sind, entsprechende Verbrechen zu verfolgen. Einige Staaten lehnen den IStGH ab, weil sie Eingriffe in die eigene staatliche Souveränität befürchten. So erkennen die USA, Russland und China die Legitimität des Gerichtshofs nicht an. Deutschland spricht sich für eine universelle Anerkennung des IStGH aus.
Externe Links:
Der Internationale Währungsfonds (IWF, englisch: International Monetary Fund, IMF) wurde im Juli 1944 auf der Währungs- und Finanzkonferenz der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen in Bretton Woods (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (USA) zusammen mit der Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gegründet. Er ist seit 1947 eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen.
Der IWF hat die Aufgabe, die Stabilität des internationalen Finanzsystems zu stärken, die internationale Zusammenarbeit in der Währungspolitik zu fördern, das Wachstum des Welthandels zu erleichtern sowie seinen Mitgliedern in Währungs- und Finanzkrisen durch Kredite zu helfen.
- Externer Link: Website des IWF (Externer Link)
Das Internationale Handelszentrum (International Trade Centre, ITC) ist ein gemeinsames Organ der Welthandelsorganisation (WTO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und der Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Ziel des Handelszentrums ist, Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bei der Förderung ihres Außenhandels zu unterstützen. Hauptzielgruppe ist die Privatwirtschaft. Zu den Aufgaben des Internationalen Handelszentrums zählen die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die Unterstützung und Beratung von Handelskammern und Handelsagenturen sowie die Beratung von Politik und Verwaltung.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Internationale Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) ist eine unabhängige Einrichtung innerhalb der Weltbankgruppe (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Seine Aufgabe ist die Schlichtung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Regierungen und ausländischen Investoren. Außerdem übernimmt das ICSID im Zusammenhang mit den gesetzlichen Bestimmungen für Auslandsinvestitionen auch Beratungsdienste, Forschungs- und Publikationsaufgaben.
Die Bundesrepublik Deutschland ist seit der Gründung des ICSID im Jahre 1966 Mitglied.
- Externer Link: Website des ICSID (englisch) (Externer Link)
Die gemeinsame Programmplanung (englisch: Joint Programming) ist ein zentrales Instrument der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), um ihre Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gemeinsam mit ihren Mitgliedsstaaten (und gegebenenfalls Drittstaaten) strategisch zu planen und politisch zu steuern. Die gemeinsame Strategie umfasst Vereinbarungen zu Zielen, zur Arbeitsteilung und zur gemeinsamen Umsetzung von Maßnahmen. Auch eine gemeinsame Wirkungsmessung ist Bestandteil des Joint Programming.
Im Rahmen des neuen Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) wurde die gemeinsame Programmplanung als Standard für die europäische Entwicklungszusammenarbeit definiert. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt diese Vorgehensweise und beteiligt sich in allen Partnerländern am Joint Programming. Nach Möglichkeit ersetzt die gemeinsame Programmplanung dann die BMZ-eigenen Länderstrategien.
siehe Beigeordnete Sachverständige (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (englisch: Junior Professional Officers, JPO)
„Just Transition“, auf Deutsch „gerechter Übergang“ oder auch „gerechter Wandel“, ist ein politisches Konzept für einen Strukturwandel hin zu einer klimaneutralen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), resilienten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und sozial gerechten Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung.
Beim Übergangsprozess werden ökologische, ökonomische und soziale Herausforderungen gleichwertig berücksichtigt, mit einem besonderen Fokus auf benachteiligte und vulnerable (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Bevölkerungsgruppen. Ziel ist, bei dem dafür erforderlichen Strukturwandel niemanden zurückzulassen, weder Einzelpersonen noch Staaten noch die zukünftigen Generationen.
Ausführliche Informationen über das Engagement des BMZ für einen Übergang zu einer klima- und sozial gerechten Wirtschafts- und Lebensweise (Just Transition) finden Sie hier.
Die Karibische Entwicklungsbank (Caribbean Development Bank, CDB) ist eine regionale Entwicklungsbank, die 1970 gegründet wurde, um Armut im karibischen Raum zu bekämpfen und eine nachhaltige wirtschaftliche sowie soziale Entwicklung der karibischen Mitgliedsstaaten zu fördern. Die CDB zählt 28 Mitglieder, von denen 19 Mittel der Bank beziehen, während neun keine Darlehen in Anspruch nehmen.
Ein besonderer Fokus der Bank liegt auf der ökologischen Nachhaltigkeit der regionalen Wirtschaftsentwicklung und der Anpassung an den Klimawandel. Die CDB vergibt Darlehen zu marktnahen Konditionen aus ihrem ordentlichen Stammkapital und stellt Zuschüsse aus dem Special Development Fund (SDF) bereit. Darüber hinaus bietet sie unentgeltliche technische Hilfe an.
Ihren Hauptsitz hat die CDB in Wildey, Saint Michael, Barbados. Deutschland ist seit 1989 nicht-regionales Mitglied der Bank und hält 5,6 Prozent der Stimmrechtsanteile.
Ausführliche Informationen über die Karibische Entwicklungsbank finden Sie hier (Externer Link).
Die Karibische Gemeinschaft (Caribbean Community, CARICOM) ist ein Zusammenschluss karibischer Staaten zur Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Wichtige Pfeiler der regionalen Integration sind die Themen Wirtschaft/gemeinsamer Markt, Koordinierung der Außenpolitik, menschliche und soziale Entwicklung und Sicherheit.
Folgende 15 Staaten bilden die Karibische Gemeinschaft (Stand: März 2024): Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Montserrat, Saint Lucia, Saint Kitts und Nevis, Saint Vincent und die Grenadinen, Suriname sowie Trinidad und Tobago. Die britischen Überseegebiete Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Caymaninseln sowie Turks- und Caicosinseln sind assoziierte Mitglieder der CARICOM.
Zusätzlich zu den Grundrechten, die in den internationalen Menschenrechtsverträgen festgelegt sind, setzen die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) universelle Mindeststandards für menschenwürdige Arbeit. Sie sind unabhängig vom Entwicklungsstand eines Landes gültig und umfassen die vier Bereiche Vereinigungsfreiheit, Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, Abschaffung der Kinderarbeit und Beseitigung der Zwangsarbeit. Diese Grundprinzipien wurden in acht Übereinkommen, den sogenannten Kernarbeitsnormen, festgehalten.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
- Stichwort: Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (ILO-Konvention 138) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Stichwort: Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (ILO-Konvention 182) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Die KfW Entwicklungsbank gehört zu den Durchführungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Innerhalb der KfW-Bankengruppe ist sie für die finanzielle Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) mit Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verantwortlich. Sie setzt da an, wo langfristiges Kapital fehlt und wo der Markt versagt oder noch nicht hinreichend funktioniert.
Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) unterstützt die KfW Entwicklungsbank ihre Partner dabei, eine wirtschaftlich tragfähige und sozial gerechte Entwicklung einzuleiten. Sie fördert Investitionen in die Infrastruktur, in Finanzsysteme (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und in den Umweltschutz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), zum Beispiel in die Ressourcensicherung. Durch den Aufbau von leistungsfähigen Finanzsystemen, die kleinen und mittleren Unternehmen neue Chancen bieten, werden Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen. In Krisenregionen trägt die KfW zum Beispiel mit Investitionen in Beschäftigungsprogramme zur Stabilisierung des sozialen Umfelds bei.
- Externer Link: Website der KfW Entwicklungsbank (Externer Link)
Zusätzlich zu den allgemeinen Menschenrechten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die allen Menschen zustehen (zum Beispiel das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit oder das Recht auf Gesundheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), gibt es Rechte, die speziell Kindern und Jugendlichen aufgrund ihres Alters zustehen. Diese Rechte wurden 1989 in der UN-Kinderrechtskonvention (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) völkerrechtlich verbindlich formuliert. Dazu zählen beispielsweise das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung sowie das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht. Im „besten Interesse des Kindes“ zu handeln, ist ein zentrales Prinzip der Kinderrechtskonvention, an das sich staatliche Behörden zum Schutz der Kinderrechte halten müssen.
Der Einsatz für die Rechte der Kinder ist eine zentrale Aufgabe der Entwicklungspolitik. Das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist insbesondere in den Bereichen Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Partizipation (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Gesundheit und Umwelt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) aktiv. Es engagiert sich im Kampf gegen Kinderarbeit, gegen den Einsatz von Kindersoldatinnen und -soldaten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie gegen Kinderhandel, sexuelle Gewalt und weibliche Genitalverstümmelung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Ausführliche Informationen zum entwicklungspolitischen Einsatz für die Kinder- und Jugendrechte finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (United Nations Children's Fund, UNICEF) arbeitet seit 1946 für das Wohl der Kinder. Es handelt auf Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention von 1989, die die Mitgliedsstaaten verpflichtet, das Überleben der Kinder zu schützen, ihre Entwicklung zu fördern, sie vor Missbrauch und Gewalt zu schützen und sie an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen. Die Arbeit von UNICEF orientiert sich an den Forderungen des Weltkindergipfels von New York (2002) sowie an den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Schwerpunkte der Arbeit von UNICEF sind Kinderrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Nothilfe- und Entwicklungsmaßnahmen.
Die Bundesregierung unterstützt UNICEF zum einen mit einem freiwilligen Regelbeitrag, zum anderen durch die Bereitstellung projektbezogener Mittel, etwa für Bildungs- und Gesundheitsprojekte. Seit 2012 ist das BMZ innerhalb der Bundesregierung federführend für die Zusammenarbeit mit UNICEF zuständig.
Weitere Informationen über die Zusammenarbeit von BMZ und UNICEF finden Sie hier.
Externe Links:
Europa
Der Europarat (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) legte 2022 seine vierte Kinderrechtsstrategie vor („Strategie von Rom“). Sie basiert auf der Kinderrechtskonvention (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen und gilt für den Zeitraum bis 2027. Formuliert werden darin Ziele in den Bereichen Freiheit von Gewalt, Chancengleichheit und soziale Inklusion, sichere Nutzung von Technologien, kindgerechte Justiz, politische und rechtliche Teilhabe sowie Rechte in Krisen- und Notsituationen.
Externer Link:
Ähnliche Themen umfasst die EU-Kinderrechtsstrategie, die 2021 von der Europäischen Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verabschiedet wurde. Sie soll dazu beitragen, Kinder besser zu schützen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen und bei der EU-Politikgestaltung in den Mittelpunkt zu stellen.
Ergänzt wird die Strategie durch die Europäische Garantie für Kinder. Sie formuliert Leitlinien für die Mitgliedsstaaten, wie Personen unter 18 Jahren unterstützt werden sollten, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind.
Mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche waren an der Erarbeitung der beiden Dokumente beteiligt.
Externe Links:
- EU-Kinderrechtsstrategie (PDF 1,4 MB) (Externer Link)
- Europäische Garantie für Kinder (PDF 646 KB) (Externer Link)
- Weiterführende Informationen zur Europäischen Garantie für Kinder (Externer Link)
Afrika
In Anlehnung an die UN-Kinderrechtskonvention trat 1999 die Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohl des Kindes in Kraft (African Charter on the Rights and Welfare of the Child). Viele Artikel der beiden Konventionen ähneln sich. Im Gegensatz zur UN-Kinderrechtskonvention enthält die afrikanische Kinderrechtscharta allerdings keinen Anspruch auf soziale Sicherung. Dafür garantiert sie einige zusätzliche Rechte, zum Beispiel das Verbot schädlicher kultureller Praktiken, welche die Gesundheit des Kindes beeinträchtigen (Artikel 21). Ein Beispiel für solche schädlichen Praktiken ist die weibliche Genitalverstümmelung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
2006 nahm die Afrikanische Union die Afrikanische Jugendcharta (African Youth Charter) an. Sie trat 2009 in Kraft und garantiert den Schutz und die Förderung der Rechte junger Menschen zwischen 15 und 35 Jahren.
Sowohl die afrikanische Kinderrechtscharta als auch die Jugendcharta verweisen auf die Pflichten junger Menschen gegenüber der Familie, der Gesellschaft, dem Staat und der internationalen Gemeinschaft.
Externe Links:
- Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohl des Kindes (PDF 532 KB, englisch) (Externer Link)
- Afrikanische Jugendcharta (PDF 6,1 MB, englisch) (Externer Link)
Pazifik und Lateinamerika
Die Pazifische Jugendcharta (Pacific Youth Charter) von 2006 und die Iberoamerikanische Jugendrechtskonvention (Convencion Iberoamericana de Derechos de los Jovenes) von 2008 orientieren sich ebenfalls an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention und passen sie regionalen Bedürfnissen an. Die Pazifische Jugendcharta wurde auf dem ersten Pazifischen Jugendfestival von rund 1.000 jungen Menschen aus 25 Ländern und Gebieten des pazifischen Raums erarbeitet. Während sich die Iberoamerikanische Jugendrechtskonvention an Menschen zwischen 15 und 24 Jahren richtet, macht die Pazifische Jugendcharta keine Angaben zum Alter ihrer Zielgruppe.
Externe Links:
Laut Schätzungen werden weltweit etwa 250.000 Minderjährige von Armeen und bewaffneten Gruppen als Kindersoldatinnen und -soldaten missbraucht. Viele von ihnen werden zu Gräueltaten gezwungen.
Kinder sind anspruchsloser und billiger als erwachsene Soldaten, sie sind leichter zu manipulieren und können sich kaum wehren. Oft werden Kinder mit Gewalt zum Kämpfen gezwungen, viele schließen sich aber auch aufgrund von Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Perspektivlosigkeit freiwillig einer Armee oder bewaffneten Gruppe an. Kindersoldatinnen leiden besonders, sie werden häufig Opfer sexualisierter Gewalt, viele müssen Zwangsehen mit Kämpfern eingehen.
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) mit den betroffenen Partnerländern hat die Aufgabe, mit gezielten Maßnahmen die gesellschaftliche Wiedereingliederung von ehemaligen Kindersoldatinnen und -soldaten zu fördern. Um ihnen eine Lebensperspektive jenseits von Krieg und Gewalt zu ermöglichen, erhalten die Kinder und Jugendlichen eine Schul- und Berufsausbildung, Unterstützung bei der Jobsuche und Zugang zur Gesundheitsfürsorge.
Ausführliche Informationen über das deutsche Engagement für Kinder in bewaffneten Konflikten finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Das „Übereinkommen von Paris“ wurde am 12. Dezember 2015 auf der Weltklimakonferenz in der französischen Hauptstadt beschlossen. Im Sinne der kurz zuvor verabschiedeten Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verpflichteten sich mit diesem Übereinkommen 195 Staaten, den Klimawandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) einzudämmen und die Weltwirtschaft klimafreundlich umzugestalten.
Die drei Hauptziele des Abkommens sind in Artikel 2 festgehalten:
- Beschränkung des Anstiegs der weltweiten Durchschnittstemperatur
- Senkung der Emissionen und Anpassung an den Klimawandel
- Lenkung von Finanzmitteln im Einklang mit den Klimaschutzzielen
Konkret heißt es in dem Abkommen, dass der weltweite Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad Celsius, auf jeden Fall aber auf deutlich unter zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter beschränkt werden soll.
Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts nicht mehr klimaschädliche Gase (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ausgestoßen werden, als der Atmosphäre durch sogenannte Kohlenstoffsenken, also etwa Wälder oder Moore, entzogen werden. Diese „Treibhausgas-Neutralität“ kann nur erreicht werden, wenn die Weltwirtschaft schnell und konsequent deutlich weniger Kohlenstoff freisetzt („Dekarbonisierung“).
Auch die Fähigkeit zur Anpassung (Adaptation) der betroffenen Länder an ein verändertes Klima soll verbessert werden und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels erhöht werden.
Eine milliardenschwere Umlenkung globaler staatlicher und privater Finanzströme in nachhaltige (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Investitionen – eines der langfristigen Ziele des Übereinkommens von Paris – ist hierzu Voraussetzung.
Alle Staaten in der Pflicht
Das Klimaabkommen regelt auch, dass sogenannte Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) finanziell sowie durch Wissens- und Technologietransfer dabei unterstützt werden, ihre Maßnahmen zum Klimaschutz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu verwirklichen.
Anders als das 2020 ausgelaufene Kyoto-Protokoll (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), das nur wenige Industriestaaten dazu verpflichtete, ihre Emissionen zu senken, bindet das Klimaabkommen von Paris alle Staaten der Erde ein. Sie haben sich völkerrechtlich verpflichtet, einen nationalen Klimabeitrag (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (englisch: Nationally Determined Contribution, NDC) und konkrete Schritte zu seiner Umsetzung zu leisten. Über die Fortschritte ihrer Bemühungen müssen die Staaten regelmäßig berichten.
Das Übereinkommen von Paris trat nach einem außergewöhnlich schnellen Ratifizierungsprozess im November 2016 in Kraft. Ende 2018 verabschiedete die Staatengemeinschaft ein umfassendes Regelwerk, das die Umsetzung des Übereinkommens im Detail festlegt.
Zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens hat die Europäische Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) 2019 den European Green Deal (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Europäischer Grüner Deal) beschlossen.
Ausführliche Informationen zum Thema Klimawandel und Entwicklungspolitik finden Sie hier.
Externer Link:
Das Konzept der Klimagerechtigkeit setzt den menschengemachten Klimawandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in Verbindung zu Themen wie Gleichheit, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit.
Am stärksten leiden jene Länder und Bevölkerungsgruppen unter den Folgen der Klimaerwärmung , die bisher am wenigsten dazu beigetragen haben. Besonders betroffen sind wirtschaftlich benachteiligte Länder. Dazu zählen viele Staaten in Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien, oft als Länder des Globalen Südens (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bezeichnet. Zusätzlich trifft es benachteiligte Gruppen, wie etwa indigene Gemeinschaften, Kleinbäuerinnen und -bauern, Frauen, Kinder sowie alte und kranke Menschen.
Das Konzept der Klimagerechtigkeit strebt an, Lasten und Chancen des Klimawandels sowohl weltweit (räumliche Dimension) als auch zwischen den Generationen (zeitliche Dimension) gerecht zu verteilen. Dazu müssen die Hauptverursacher des Klimawandels – Industriestaaten sowie mittlerweile auch einige sogenannte Schwellen- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) – nicht nur ihren Ausstoß von Treibhausgasen drastisch verringern. Sie stehen auch in der Verantwortung, die vulnerabelsten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Bevölkerungsgruppen dabei zu unterstützen, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen, klimabedingte Schäden und Verluste zu bewältigen und den Wandel zu einer klimaneutralen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensweise zu vollziehen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Der Begriff Klimamigration beinhaltet verschiedene Aspekte menschlicher Mobilität: Vertreibungen durch Extremwetterereignisse und Katastrophen, (freiwillige) Migrationsentscheidungen aufgrund von Auswirkungen des Klimawandels sowie geplante und freiwillige Umsiedlungen. Um Klimamigration zu beschreiben, wird in Fachdiskussionen häufig der Begriff „klimawandelbedingte menschliche Mobilität“ verwendet. Meistens findet klimabedingte Migration innerhalb eines Landes statt, teilweise auch über Grenzen hinweg.
Der Status von „Klimamigrantinnen und -migranten“ ist noch weitgehend undefiniert. Es gibt bislang keine internationale Rechtsgrundlage, auf die sich Menschen berufen könnten, die aufgrund der Folgen des Klimawandels ihr Herkunftsland verlassen müssen oder die sich angesichts der absehbaren Folgen dafür entscheiden zu migrieren.
Die Genfer Flüchtlingskonvention (Externer Link) lässt sich hier nicht anwenden. Es gibt jedoch politische Initiativen, die die Situation dieser Menschen ändern wollen – zum Beispiel die Protection Agenda der Nansen-Initiative. Sie wurde 2015 von 109 Ländern gebilligt und hat das Ziel, den Schutz von „Klimamigrantinnen und -migranten“ auf nationaler und regionaler Ebene sicherzustellen. Zur Umsetzung der Protection Agenda wurde die Initiative Platform on Disaster Displacement (Externer Link) (PDD) ins Leben gerufen, bei der sich Deutschland aktiv einbringt.
Auch Umweltveränderungen und Naturkatastrophen, die nicht durch den Klimawandel verursacht werden, können Menschen dazu bringen, ihre Heimat zu verlassen. Der Begriff „Umweltmigration“ fasst sämtliche Migrationsbewegungen zusammen, die auf geänderten Umweltbedingungen beruhen.
Klimaneutralität bedeutet, dass menschliches Handeln das Klima insgesamt nicht beeinflusst. Eine klimaneutrale Wirtschaft setzt also entweder keine klimaschädlichen Treibhausgase (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) frei oder die Emissionen werden vollständig ausgeglichen.
Oft wird Klimaneutralität mit CO₂-Neutralität gleichgesetzt, wobei der Einfluss anderer Treibhausgase wie Methan außer Acht gelassen wird. CO₂-Neutralität bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen dem Ausstoß von Kohlendioxid und der Bindung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in sogenannten Kohlenstoffsenken herzustellen. Kohlenstoffsenken sind Systeme, die mehr Kohlenstoff aufnehmen, als sie abgeben. In der Natur sind dies vor allem Böden, Wälder und Ozeane. Werden sie geschädigt oder zerstört, etwa durch landwirtschaftliche Nutzung oder Abholzung, wird der gespeicherte Kohlenstoff wieder freigesetzt.
Der Klimawandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) hat globale Auswirkungen: Alle Staaten müssen aktiv werden, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken und der weiteren Erderwärmung Einhalt zu gebieten, wobei großen Emittenten eine besondere Verantwortung zukommt. Mit der Konvention der Vereinten Nationen über den Klimawandel (1992), dem Kyoto-Protokoll (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (1997) und dem Klimaabkommen von Paris (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (2015) hat die Staatengemeinschaft wichtige Regelwerke zum Klimaschutz geschaffen.
Im 2015 in Paris verabschiedeten Klimaabkommen wurde das Ziel formuliert, den weltweiten Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad Celsius, auf jeden Fall aber auf deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu beschränken. Damit dieses ehrgeizige Ziel erreicht werden kann, ist ein tiefgreifender technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen und klimafreundlichen Wirtschaft erforderlich („Dekarbonisierung“). Der Ausstoß von Treibhausgasen muss vor allem in den Bereichen Energie, Stadtentwicklung, Verkehr sowie Land- und Forstwirtschaft schnellstmöglich gemindert werden. Dafür muss insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) massiv ausgebaut werden.
Ausführliche Informationen über entwicklungspolitische Ansätze zum Klimaschutz finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Seit Beginn der Industrialisierung um 1800 wurden die Verbrennung von Kohle, Gas und Öl, die Abholzung von Wäldern und die Massentierhaltung enorm ausgeweitet. Dadurch hat der Ausstoß von Treibhausgasen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zugenommen, die als Verursacher für die Erwärmung der Erde gelten. Inzwischen ist die globale Durchschnittstemperatur deutlich angestiegen. Dies hat unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen der Erde – etwa schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel, eine zunehmende Zahl von Extremwetterereignissen und veränderte Ökosysteme.
Bislang haben die Industrieländer den größten Anteil der Energieträger Erdöl, Kohle und Gas verbraucht. Sie sind damit aus historischer Sicht hauptverantwortlich für den Klimawandel. Inzwischen gehören jedoch auch sogenannte Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und insbesondere auch sogenannte Schwellenländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu den größten Produzenten von Treibhausgasen. Gleichzeitig sind diese Länder in besonderem Maße von den unmittelbaren Folgen des Klimawandels betroffen – von häufigeren Wetterextremen und Naturkatastrophen wie Dürren und Überflutungen, zunehmender Trinkwasserknappheit und von einem beschleunigten Artensterben.
Es besteht weltweit Einvernehmen darüber, dass die globale Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius, auf jeden Fall aber auf deutlich unter zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden muss, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Dazu ist internationale Zusammenarbeit beim Klimaschutz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) notwendig.
Ausführliche Informationen über entwicklungspolitische Ansätze zum Klimaschutz finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
In der Politik steht Kohärenz (lateinisch: cohaerere = zusammenhängen) für Abstimmung, etwa wenn verschiedene Ministerien innerhalb einer Regierung oder die Mitgliedsstaaten der EU ihre Politik aufeinander abstimmen, um eine einheitliche Linie zu gewährleisten und die gewünschte Wirkung zu erzielen. In der entwicklungspolitischen Diskussion wird das Wort Kohärenz auch so verstanden, dass alle Politikbereiche eine Mitverantwortung für Entwicklung tragen. In diesem Sinne wird auch von Politikkohärenz für Entwicklung (englisch: Policy Coherence for Development, PCD) gesprochen.
So soll beispielsweise die Agrarpolitik Maßnahmen vermeiden, die entwicklungspolitische Ziele beeinträchtigen könnten. Sie soll, wo möglich, die Ziele der Entwicklungspolitik ergänzen und unterstützen oder zumindest nicht negativ beeinflussen. Das Gleiche gilt für alle Politikfelder, in denen die Entscheidungen der Geberländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) das Leben der Menschen in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) beeinflussen.
Politikkohärenz für Entwicklung ist wichtig, damit entwicklungspolitische Maßnahmen nachhaltig (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) wirken können. Die Verbesserung der Kohärenz ist daher ein zentrales Ziel der Entwicklungspolitik.
Mit kolonialen Kontinuitäten (oder auch nur kurz: Kolonialität) werden Strukturen, Denk- und Handlungsmuster bezeichnet, die in der Kolonialzeit entstanden sind und auch heute noch Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung und unser Handeln haben. Koloniale Kontinuitäten beeinflussen die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Globalen Süden und dem Globalen Norden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie gehören zu den Ursachen von Machtgefällen, Abhängigkeitsverhältnissen, unbewussten Vorurteilen und rassistischen Strukturen.
Das Bundesentwicklungsministerium (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (BMZ) hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für koloniale Kontinuitäten zu schärfen. Denkmuster, Strukturen und Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) werden vor diesem Hintergrund stets kritisch hinterfragt. Um die deutsche Entwicklungszusammenarbeit partnerorientierter zu gestalten, wird das BMZ unter anderem in Zukunft noch stärker auf lokales Fachwissen aus dem Globalen Süden zurückgreifen. Außerdem engagiert sich das BMZ dafür, die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Länder des Globalen Südens in internationalen Organisationen und Institutionen zu stärken.
Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Zeitalter des Kolonialismus begann im 15. Jahrhundert, als zunächst Portugal und Spanien Handels- und Militärstützpunkte außerhalb von Europa einrichteten. Später besetzten auch die Niederlande, England, Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, Russland, Japan und die USA ausländische Gebiete und unterwarfen sie gewaltsam ihrer Herrschaft. Ende des 19. Jahrhunderts hatten die großen Kolonialmächte weite Teile der Welt unter sich aufgeteilt und beuteten ihre Ressourcen aus.
Deutschland begann 1884 mit der Annexion von Kolonien in Afrika und Asien. Nach Fläche bemessen verfügte Deutschland im Jahr 1914 über das drittgrößte Kolonialreich nach Großbritannien und Frankreich. Es umfasste unter anderem Teile der heutigen Staaten Burundi, Ruanda, Tansania, Namibia, Kamerun, Togo, Ghana, China, Papua-Neuguinea sowie mehrere Inseln im Westpazifik. Nach dem Ersten Weltkrieg musste Deutschland seine Kolonien vollständig an andere Kolonialmächte abtreten.
Dekolonisierung
Die weltweite Dekolonisierung erfolgte in mehreren Phasen. Während sich die Staaten in Lateinamerika schon im 19. Jahrhundert von der spanischen beziehungsweise portugiesischen Herrschaft befreiten, erkämpften die meisten Länder in Afrika in den 1960er Jahren ihre Unabhängigkeit.
Die Unterschiede zwischen den ehemaligen Kolonialmächten und den ehemaligen Kolonien blieben jedoch weitgehend bestehen, sowohl mit Blick auf die Wohlstandsverteilung als auch in Bezug auf den globalen politischen und wirtschaftlichen Einfluss. Sie bestimmen bis heute auch die internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Die deutsche Kolonialgeschichte wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Aufarbeitung der NS-Zeit weitgehend überdeckt. In den vergangenen Jahren hat die kritische Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit in der Öffentlichkeit, Politik, Wissenschaft und Kultur deutlich zugenommen. Die intensiven Bezüge der heutigen deutschen und europäischen Kultur zu Machtstrukturen und Auffassungen, die auf den Kolonialismus zurückgehen, werden aber bisher in der Öffentlichkeit oder auch in Bildungseinrichtungen nur wenig diskutiert.
Das könnte Sie auch interessieren:
Stichwort: Koloniale Kontinuitäten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Kolping International ist ein katholischer Sozialverband, der 1850 durch den Priester und Sozialreformer Adolph Kolping gegründet wurde. Die rund 400.000 Mitglieder sind in mehr als 9.000 Kolpingsfamilien in 60 Ländern organisiert. Über die verbandseigene Fachorganisation Kolping International Cooperation betreibt der Verband Entwicklungsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Mittel- und Osteuropa.
Kolping International arbeitet nach dem Prinzip der aktiven „Hilfe zur Selbsthilfe“. Das Engagement reicht von Hausbauprojekten für arme Familien über Ausbildungsplätze für Jugendliche und Kleinkredite für Handwerker bis hin zu medizinischer Betreuung und zur Unterstützung für Aids (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Waisen.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Ein wichtiges Ziel der deutschen Entwicklungspolitik ist es, den Partnerländern im Krisenfall zu helfen, Konflikte gewaltfrei zu beenden. Entsprechende Maßnahmen tragen dazu bei, die Lage zu entschärfen und gemeinsam mit Entscheidungsträgern in Politik, Staat und Gesellschaft friedliche Lösungen zu entwickeln. Bei der Konfliktbewältigung setzt das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) hauptsächlich Instrumente der technischen Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ein. So werden zum Beispiel Regierungen bei der Umsetzung von Reformen beraten und lokale Friedensprojekte gefördert.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) ist nach dem CDU-Politiker und ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, benannt. Sie steht der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) nahe und setzt sich national und international durch politische Bildung für Frieden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Freiheit und Gerechtigkeit ein. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die Festigung der Demokratie (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die Förderung der europäischen Einigung, die Intensivierung der transatlantischen Beziehungen und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
- Externer Link: Website der Konrad-Adenauer-Stiftung (Externer Link)
Als Reaktion auf den nationalsozialistischen Völkermord an europäischen Jüdinnen und Juden verabschiedete die Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen 1948 die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Sie trat 1951 in Kraft und definiert Völkermord als Handlungen, die in der Absicht begangen werden, „eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“.
153 Staaten haben die Konvention ratifiziert (Stand: September 2024). Die Bundesrepublik Deutschland trat der Konvention 1954 bei, die Deutsche Demokratische Republik 1973.
Seit 2002 können schwere Menschenrechtsverletzungen wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord vor dem Internationalen Strafgerichtshof (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verhandelt werden.
Externer Link:
Menschen, die ihr Geburtsland verlassen, um in einem anderen Land Arbeit zu suchen, finden sich oft in Situationen wieder, in denen ihre Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verletzt werden. Im Herkunftsland werden sie zum Beispiel von Menschenhändlerinnen und Menschenhändlern ausgenutzt. Im Zielland werden sie häufig ausgebeutet, weil sie die Landessprache und Rechtsordnung nicht kennen oder weil die Rechtsordnung Migrantinnen und Migranten diskriminiert.
Um den Schutz dieser Personengruppe zu gewährleisten, verabschiedete die UN-Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) 1990 die Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen. Sie ist seit 2003 in Kraft.
Die Wanderarbeiterkonvention schützt „jede Person, die in einem Staat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht hat, eine Tätigkeit gegen Entgelt ausüben wird, ausübt oder ausgeübt hat“. Sie schreibt die Gewährleistung von Grundrechten für alle Migrantinnen und Migranten fest, zum Beispiel das Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit, die Garantie der Rechtsfähigkeit und das Recht auf Rückkehr in den Herkunftsstaat. Sie enthält auch ein Informationsrecht. Die Konventionsrechte gelten auch für Menschen, die sich in einer irregulären Migrationssituation befinden. Einen Rechtsanspruch auf eine Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis beinhaltet die Konvention nicht.
Die Wanderarbeiterkonvention haben 59 Staaten ratifiziert (Stand: September 2024), die meisten Zielländer von Migration und auch Deutschland nicht.
Externer Link:
Korruption ist der Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Durch Korruption werden öffentliche Gelder verschwendet, statt mit ihnen nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) im Interesse aller Bevölkerungsgruppen zu fördern. Korruption hemmt Entwicklung und trägt zu andauernder Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bei. Gleichzeitig untergräbt sie die Wirksamkeit von Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Die Prävention und Bekämpfung von Korruption ist deshalb ein zentrales Anliegen der deutschen Entwicklungspolitik.
Seit 1997 werden in allen Regierungsverhandlungen Antikorruptionsvereinbarungen mit den Partnerländern geschlossen. Es gilt das Null-Toleranz-Prinzip: Droht der Missbrauch deutscher Entwicklungsgelder, kann ihre Auszahlung gestoppt werden.
Ausführliche Informationen über das deutsche Engagement zur Bekämpfung der Korruption finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Gewalt zu verhindern, bevor sie ausbricht, ist das Ziel der Krisenprävention. Voraussetzung ist, die Faktoren zu erkennen, die zu Konflikten führen können – zum Beispiel übermäßig große soziale Unterschiede, die ungerechte Verteilung knapper Ressourcen oder die Missachtung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Wichtige Arbeitsfelder der Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sind in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Förderung guter Regierungsführung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Umwelt- und Ressourcenschutz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Wirtschaftsförderung sowie die Stärkung der Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Das könnte Sie auch interessieren:
1992 verabschiedete die internationale Staatengemeinschaft bei der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in Rio de Janeiro das erste völkerrechtlich verbindliche Abkommen zum Klimaschutz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).
1997 trafen sich die Vertragsstaaten in der japanischen Stadt Kyoto, um über die konkrete Umsetzung der Klimarahmenkonvention zu verhandeln. Als Ergebnis einigten sich die Teilnehmer auf das sogenannte Kyoto-Protokoll. Es war das bis dahin weitreichendste Umweltabkommen, das jemals unterzeichnet worden war, weil es auf alle Wirtschaftsbereiche konkrete Auswirkungen hatte. Nach einem zeitaufwendigen Ratifizierungsprozess trat das Kyoto-Protokoll im Februar 2005 in Kraft. Die USA haben es als einziger Industriestaat nicht ratifiziert.
Das zentrale Ziel des Kyoto-Protokolls bestand darin, den Ausstoß der sechs wichtigsten Treibhausgase (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu begrenzen. Im Zeitraum von 2008 bis 2012 sollte er im Durchschnitt um 5,2 Prozent im Vergleich zum Wert von 1990 gesenkt werden. Deutschland verpflichtete sich, seinen Treibhausgas-Ausstoß im genannten Zeitraum um 21 Prozent zu senken und hat dieses Ziel erreicht.
Nach mehrjährigen Verhandlungsrunden einigten sich die Vertragsstaaten 2012 auf der Klimakonferenz in Doha (Katar) auf eine Verlängerung des Kyoto-Protokolls bis 2020. Allerdings nahmen nicht mehr alle Vertragsstaaten an dieser zweiten Verpflichtungsperiode teil.
In Nachfolge des Kyoto-Protokolls wurde im Dezember 2015 das Klimaabkommen von Paris (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verabschiedet.
Ausführliche Informationen über das Thema Klimawandel und Entwicklung finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Entwicklung ländlicher Räume ist die Grundlage für die Reduzierung des Hungers (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und für die langfristige Sicherung der Welternährung. Die meisten armen und an Hunger leidenden Menschen auf der Welt leben in ländlichen Räumen. Landflucht, Raubbau an natürlichen Ressourcen und gewaltsame Konflikte haben in diesen Räumen vielerorts besorgniserregende Ausmaße angenommen. Der Klimawandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Ländliche Räume bieten aber gleichzeitig enorme Potenziale, die lange nicht erkannt wurden: Neben Nahrungsmitteln werden Holz, Baumwolle, Energiepflanzen, Pflanzenöle und andere Grundstoffe produziert; ländliche Räume haben darüber hinaus wichtige Aufgaben beim Erhalt der biologischen Vielfalt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und beim Klimaschutz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) fördert diese Gebiete deshalb als Schlüsselräume für Entwicklung, Armutsreduzierung und Hungerbekämpfung.
Ausführliche Informationen über entwicklungspolitische Ansätze zur Entwicklung ländlicher Räume finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die „am wenigsten entwickelten Länder“ (englisch: Least Developed Countries, LDC) sind eine von den Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) definierte Gruppe besonders armer Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
- Externer Link: Liste der LDC (englisch) (Externer Link)
Der Lebenslageansatz dient der Bewertung von Armut und fasst den Armutsbegriff weiter als der Ressourcenansatz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Neben dem Einkommen berücksichtigt er auch andere Aspekte, die für ein menschenwürdiges Leben nötig sind – zum Beispiel Bildungschancen, Lebensstandard, Selbstbestimmung, Rechtssicherheit, Einfluss auf politische Entscheidungen und vieles mehr. Um den Lebenslageansatz mit einer greifbaren und vergleichbaren Zahl erfassen zu können, errechnet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) den Index der menschlichen Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Human Development Index, HDI). Er beschreibt den Entwicklungsstand eines Landes anhand einer Skala, die von 0 bis 1 reicht. Indikatoren für den HDI sind unter anderem die Lebenserwartung bei der Geburt, die Alphabetisierungsrate, das Bildungsniveau und die reale Kaufkraft pro Kopf.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Stichwort: Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Um den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt in globalen Lieferketten zu verbessern, hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gemeinsam mit dem Bundesarbeits- und dem Bundeswirtschaftsministerium ein Lieferkettengesetz erarbeitet. Das „Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten“ (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG, Kurzform: Lieferkettengesetz) wurde im Juni 2021 vom Bundestag verabschiedet und trat zum 1. Januar 2023 in Kraft.
Durch das Gesetz werden Unternehmen in Deutschland verpflichtet, bestimmte Sorgfaltspflichten zu erfüllen: Sie müssen ermitteln, ob ihre Geschäftstätigkeit zu Menschenrechtsverletzungen oder bestimmten Umweltrisiken führen kann. Diese Sorgfaltspflichten erstrecken sich dabei grundsätzlich auf die gesamte Lieferkette – von der Rohstoffgewinnung bis zur Lieferung an den Endkunden. Bei klaren Hinweisen auf Verstöße müssen die Unternehmen sofort angemessene Maßnahmen ergreifen, um diese Verletzung zu verhindern, zu beenden oder zumindest ihr Ausmaß deutlich zu verringern. Außerdem sind sie verpflichtet, ein Beschwerdeverfahren für potenziell Betroffene einzurichten.
Auch auf EU-Ebene wird es eine Regelung zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten geben – das hat die Mehrheit der EU-Staaten im März 2024 beschlossen. Am 24. April 2024 hat das Europaparlament (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) die EU-Lieferkettenrichtlinie (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) verabschiedet. Nach abschließender Zustimmung durch den EU-Ministerrat am 24. Mai 2024 muss die Richtlinie bis 2026 in nationales Recht umgesetzt werden.
Ausführliche Informationen zum Thema Lieferketten finden Sie hier.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Abkürzung LSBTIQ+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen und weitere Geschlechtsidentitäten. Der Begriff wird vor allem in den Industrieländern und im thematischen Zusammenhang mit den Menschenrechten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) benutzt. Geläufig ist außerdem die englische Abkürzung LGBTQI+.
Menschen mit einer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität, die nicht den gesellschaftlichen Mehrheitsnormen entspricht, werden in vielen Ländern rechtlich diskriminiert und gesellschaftlich ausgegrenzt. Sie sind zudem einem erhöhten Risiko von Gewalt ausgesetzt. Schätzungen gehen davon aus, dass sich mindestens zwei bis zehn Prozent der Bevölkerung der Gruppe der LSBTIQ+-Personen zugehörig fühlen.
Das BMZ unterstützt zivilgesellschaftliche (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Organisationen, die sich für die Menschenrechte von LSBTIQ+-Personen und gegen die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität einsetzen.
Hintergrund
Lesben und Schwule (auch als Homosexuelle bezeichnet) sind Menschen, die sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen. Bisexuelle Menschen fühlen sich sowohl von Männern als auch von Frauen sexuell angezogen. Seit Oktober 2017 besteht in Deutschland das Recht der Ehe für alle. Gleichgeschlechtliche Paare können nun wie heterosexuelle Paare die Ehe eingehen.
Transsexuell, transgender oder auch nur trans ist ein Begriff für Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Transsexuelle können sich als männlich oder weiblich identifizieren oder auch als außerhalb dieses auf zwei Geschlechter beschränkten Systems stehend.
Bei intersexuellen Menschen können die körperlichen Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden. In Deutschland haben intersexuelle Personen seit 2018 das Recht, ihr Geschlecht offiziell als „divers“ eintragen zu lassen.
Mehr zum Thema finden Sie hier.
Mainstreaming (englisch, frei übersetzt: „zur Hauptströmung machen“) bedeutet, dass eine bestimmte inhaltliche Vorgabe – also zum Beispiel die Integration von Menschen mit Behinderungen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) – zu einem zentralen Bestandteil bei allen Entscheidungen und Prozessen gemacht wird und dass dabei die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen aller Beteiligten umfassend berücksichtigt werden.
In der Entwicklungspolitik wird unter anderem in den Bereichen Gleichstellung der Geschlechter (Gender-Mainstreaming (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), Integration von Menschen mit Behinderungen und Bekämpfung von HIV (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)/Aids (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ein Mainstreaming-Ansatz verfolgt.
Beispiel: Mainstreaming der HIV/Aids-Bekämpfung
Entwicklungsfaktoren wie Armut, Geschlechterungleichheit, mangelhafter Zugang zu öffentlichen Diensten, Migration und gesellschaftliche Instabilität sind zugleich Ursachen und Folgen von HIV-Infektionen. Um in einem Land die Aids-Pandemie erfolgreich bekämpfen zu können, ist eine nationale Strategie notwendig, die alle an der Entwicklung eines Landes beteiligten Akteure, Aktionsebenen und Sektoren einbezieht. Für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bedeutet dies, in einem gemeinsamen Prozess konkrete Schritte für die unterschiedlichen Sektoren zu vereinbaren und umzusetzen. So werden zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft Arbeitsplatzprogramme aufgelegt, die zur Gesundheitsförderung und damit zum Erhalt der Arbeitskraft beitragen.
Nach Schätzungen leben weltweit über eine Milliarde Menschen mit Behinderungen, 80 Prozent von ihnen in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Viele von ihnen sind vom politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben ausgeschlossen – ein Verstoß gegen ihre grundlegenden Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) wurde 2006 von den Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verabschiedet und trat 2008 in Kraft. Sie reduziert Menschen mit Behinderungen nicht auf ihre medizinischen Bedürfnisse, sondern formuliert eine „soziale“ Definition von Behinderung. Demnach zeichnet sich Behinderung weniger durch individuelle Eigenschaften wie zum Beispiel körperliche Beeinträchtigungen aus, sondern vielmehr durch Barrieren in der Umwelt und durch negative Einstellungen bei den Mitmenschen.
Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet mit Artikel 32 alle Vertragsstaaten, ihre Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) inklusiv zu gestalten, so dass auch Menschen mit Behinderungen Zugang zu Entwicklungsprogrammen haben und durch sie in ihren Rechten gefördert werden. Um das Armutsrisiko von Menschen mit Behinderungen zu mindern, werden in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit inklusive Ansätze unter anderem in den Bereichen Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Gesundheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), soziale Sicherung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Beschäftigung gefördert.
Ausführliche Informationen zum entwicklungspolitischen Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen finden Sie hier.
Jeder Mensch hat Anspruch auf bestimmte angeborene Rechte und Freiheiten. Menschenrechte sind universell, gelten also überall und für alle Menschen. Sie sind unveräußerlich, können also nicht freiwillig aufgegeben oder abgetreten werden. Und sie sind unteilbar, man kann also nicht ein Recht auf Kosten eines anderen verwirklichen. Menschenrechte sind in zahlreichen völkerrechtlichen Vereinbarungen festgeschrieben.
Zu den bürgerlichen und politischen Menschenrechten zählen zum Beispiel das Recht auf Leben und das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Rechte auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs-, und Vereinigungsfreiheit, die Gleichberechtigung der Geschlechter sowie der Schutz vor Folter oder Sklaverei.
Zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten (WSK-Rechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) gehören unter anderem die Rechte auf Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Gesundheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Nahrung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und auf soziale Sicherheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Die Bundesregierung versteht Entwicklungspolitik als praktische Menschenrechtspolitik.
Ausführliche Informationen über entwicklungspolitische Ansätze zur Verwirklichung der Menschenrechte finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Stichwort: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Stichwort: Frauenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Stichwort: Kinder- und Jugendrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Stichwort: LSBTIQ+ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Stichwort: Indigene Völker (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Menschen, die auf der Suche nach besseren Lebensperspektiven aus eigenem Antrieb ihre Heimat verlassen, nennt man Migrantinnen und Migranten. Sie wandern aus, um vorübergehend oder für immer an einem anderen Ort zu leben.
Menschen, die weder über ein reguläres Visum noch über einen legalen Aufenthaltsstatus verfügen, um in ein Land einzureisen beziehungsweise dort zu bleiben, gelten als irreguläre Migrantinnen und Migranten.
Das Völkerrecht zieht eine klare Trennlinie zwischen Migranten und Flüchtlingen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Migrantinnen und Migranten fallen nicht unter das internationale Flüchtlingsschutzsystem.
Mehr zum Thema Migration finden Sie hier.
Viele Menschen in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) haben keinen Zugang zu bedarfsgerechten Finanzdienstleistungen. Sie erhalten keine Bankkredite, weil sie entweder nicht über die notwendigen Sicherheiten verfügen oder nicht im Einzugsbereich einer Bank leben. Viele Kunden sind zudem für Banken nicht interessant, weil sie nur kleine Summen brauchen. Mikrofinanzierung kann diese Versorgungslücke schließen. Entsprechende Finanzsysteme werden oft von Interessensgruppen aufgebaut, zum Beispiel von Fraueninitiativen, die gemeinsam erwirtschaftetes Geld an andere Frauen verleihen.
Mikrofinanzdienstleistungen müssen langfristig professionell und verantwortungsvoll umgesetzt werden, um negative Wirkungen wie Mehrfachkreditaufnahmen und Überschuldung zu vermeiden. Damit sich Mikrokreditnehmer nicht überschulden, achtet das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) auf die Einhaltung strenger Kriterien. Alle von Deutschland geförderten Mikrofinanzinstitutionen verpflichten sich, Prinzipien verantwortungsvoller Kreditvergabe umzusetzen.
Neben der Vergabe von Krediten umfasst Mikrofinanzierung eine breite Palette von weiteren Finanzdienstleistungen. Dazu gehören zum Beispiel auch Sparkonten und Versicherungen. Mikroversicherungssysteme ermöglichen Menschen mit niedrigem oder unregelmäßigem Einkommen, mit geringen Beiträgen Versicherungen abzuschließen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wichtig ist dabei, dass die Zielgruppen mit Versicherungsprinzipien vertraut gemacht und Versicherungsprodukte möglichst einfach und verständlich gehalten werden. Zudem müssen solche Systeme finanziell tragfähig sein.
Im September 2000 kamen hochrangige Vertreter von 189 Ländern zu dem bis dahin größten Gipfeltreffen der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in New York zusammen (Millenniumskonferenz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Als Ergebnis des Treffens verabschiedeten sie die sogenannte Millenniumserklärung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Aus ihr wurden später acht internationale Entwicklungsziele abgeleitet, die Millenniumsentwicklungsziele (englisch: Millennium Development Goals, MDGs), die bis zum Jahr 2015 erreicht werden sollten:
- den Anteil der Weltbevölkerung, der unter extremer Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Hunger (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) leidet, halbieren
- allen Kindern eine Grundschulausbildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ermöglichen
- die Gleichstellung der Geschlechter fördern und die Rechte von Frauen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) stärken
- die Kindersterblichkeit verringern
- die Gesundheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Mütter verbessern
- HIV (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)/Aids (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Malaria und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen
- den Schutz der Umwelt verbessern
- eine weltweite Entwicklungspartnerschaft aufbauen
Im Geltungszeitraum der MDGs wurden große Fortschritte erzielt und die Lebensverhältnisse von Millionen Menschen deutlich verbessert. Doch nicht alle Ziele wurden erreicht. Um auf Erfolgen aufzubauen, Lehren aus den Erfahrungen zu ziehen und um die gemeinsamen Anstrengungen fortzusetzen, verabschiedete die Staatengemeinschaft 2015 neue globale Entwicklungsziele: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Die Millenniumserklärung wurde auf der Millenniumskonferenz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) im September 2000 verabschiedet. Sie definierte vier programmatische, sich wechselseitig beeinflussende und bedingende Handlungsfelder für die internationale Politik:
- Frieden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Sicherheit und Abrüstung
- Entwicklung und Armutsbekämpfung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Schutz der gemeinsamen Umwelt
- Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Demokratie (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und gute Regierungsführung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Aus der Erklärung wurden später acht internationale Entwicklungsziele abgeleitet, die Millenniumsentwicklungsziele (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (englisch: Millennium Development Goals, MDGs).
Im September 2000 kamen hochrangige Vertreter von 189 Ländern, die meisten von ihnen Staats- und Regierungschefs, in New York zu dem bis dahin größten Gipfeltreffen der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zusammen, um über die zentralen Herausforderungen zu Beginn des neuen Jahrtausends zu diskutieren. Als Ergebnis des Treffens verabschiedeten sie die sogenannte Millenniumserklärung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Das könnte Sie auch interessieren:
Misereor ist die zentrale Organisation der katholischen Kirche für Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien. Sie wurde 1958 als Hilfswerk „gegen Hunger und Krankheit in der Welt“ gegründet. Misereor soll weltweit dazu beitragen, Krankheit, Armut und andere Formen menschlichen Leidens zu lindern. Durch Hilfe zur Selbsthilfe soll eine dauerhafte Verbesserung der Lebensverhältnisse ermöglicht werden.
- Externer Link: Website von Misereor (Externer Link)
Im Juni 2005 beschlossen die Finanzminister der damals in der Gruppe der 8 (G8) kooperierenden Staaten die sogenannte Multilaterale Entschuldungsinitiative (Multilateral Debt Relief Initiative, MDRI). Sie knüpft an den Mechanismus der HIPC-Initiative (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) an. Länder, die eine Entschuldung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) im Rahmen der HIPC-Initiative erreicht haben, können einen vollständigen Erlass ihrer Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), bei der Weltbanktochter (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) IDA (International Development Association) und dem Afrikanischen Entwicklungsfonds (ADF (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) erhalten.
Die Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) ist Teil der Weltbankgruppe (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie sichert privatwirtschaftliche Direktinvestitionen in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) durch Garantien gegen politische Risiken ab. Dazu zählen zum Beispiel Krieg, Unruhen, Enteignung, Vertragsbruch und staatlich angeordnete Einschränkungen des Zahlungstransfers ins Ausland. Die MIGA bietet außerdem technische Hilfe und Investitionsberatung an.
Die Bundesrepublik Deutschland ist Gründungsmitglied der MIGA.
- Externer Link: Website der MIGA (englisch) (Externer Link)
In der Politik verwendet man den Begriff „multilateral“ (lateinisch: vielseitig), wenn mehrere Staaten gleichberechtigt zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen oder grenzüberschreitende Probleme zu lösen. Zwischenstaatliche Organisationen wie die Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) oder die Weltbankgruppe (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sind wichtige Akteure der multilateralen Zusammenarbeit. Sie stützen sich auf eine breite Mitgliedschaft, sind politisch neutral und verfügen über Kapital und umfassendes Fachwissen. Multilaterale Institutionen verwirklichen in den Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) groß angelegte Programme und koordinieren häufig die Leistungen verschiedener Geber (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Die Mitgliedschaft in zahlreichen internationalen Organisationen ermöglicht es Deutschland, seine Positionen und Erfahrungen in die internationale Politik einzubringen.
Informationen zur multilateralen Zusammenarbeit des BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) finden Sie hier.
Der Multilaterale Fonds des Montrealer Protokolls wurde 1990 eingerichtet, um das Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht der Erde und zur Vermeidung ozonschädlicher Substanzen umzusetzen. Der Fonds wird aus Beiträgen der Industrieländer gespeist und trägt die zusätzlichen Kosten, die Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) durch die Einhaltung des Montrealer Protokolls entstehen.
Für die Umsetzung bedient sich der Fonds der internationalen Durchführungsorganisationen Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Bis November 2023 wurden in den Multilateralen Fonds mehr als 4,7 Milliarden US-Dollar eingezahlt.
- Externer Link: Website des Multilateralen Fonds (englisch) (Externer Link)
Eine leistungsfähige Wirtschaft, die Arbeitsplätze schafft, ist die entscheidende Voraussetzung für die Minderung der Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Denn Arbeit schafft Einkommen und gibt den Menschen die Chance, sich selbst aus ihrer Armut zu befreien. In der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Partnerländern fördert das Bundesentwicklungsministerium (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) daher Strategien, die ein breiten- und beschäftigungswirksames Wachstum zum Ziel haben, das armen Menschen einen Weg aus der Einkommensarmut bietet („Pro-Poor Growth“). Dazu zählen zum Beispiel die Förderung stabiler wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen und eines guten Investitionsklimas, die Förderung der Privatwirtschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), das Angebot von Finanzdienstleistungen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen und der Aufbau von Berufsbildungssystemen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Dabei ist es wichtig, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – wirtschaftlich effizient, sozial gerecht, ökologisch tragfähig – gleichberechtigt zu betrachten. Um die globalen Ressourcen langfristig zu erhalten, sollte Nachhaltigkeit die Grundlage aller politischen Entscheidungen sein.
Seit der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die 1992 in Rio de Janeiro stattfand, ist die nachhaltige Entwicklung als globales Leitprinzip international akzeptiert. Konkrete Ansätze zu ihrer Umsetzung finden sich in der in Rio verabschiedeten Agenda 21 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Das könnte Sie auch interessieren:
- Externer Link: Rat für Nachhaltige Entwicklung (Externer Link)
Die nationalen Klimabeiträge (englisch: Nationally Determined Contributions, NDCs) bilden das Herzstück des Pariser Klimaabkommens (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) von 2015. Alle Vertragsstaaten – sowohl Industrie- als auch Entwicklungs- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Schwellenländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) – haben sich verpflichtet, eigenständig festzulegen, wie stark sie ihre Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2030 senken und wie sie sich an den Klimawandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) anpassen wollen. Die Idee: Werden die Ziele nicht „von oben herab“ verordnet, sondern als Selbstverpflichtung festgelegt, stoßen sie auf mehr Akzeptanz.
Die Länder melden ihre nationalen Klimabeiträge dem UN-Klimasekretariat. Dieses prüft sie und ermittelt den Gesamtnutzen für das Weltklima. Wenn die Beiträge nicht ausreichen, um die globale Erwärmung wie vereinbart deutlich unter zwei Grad Celsius zu beschränken, sollen die NDCs nachgebessert werden. Für dieses „Nachbessern“ hat das Pariser Klimaabkommen einen langfristigen Prozess in Gang gesetzt, die sogenannte Globale Bestandsaufnahme.
Bis 2020 konnten die Staaten ihre Beiträge anpassen oder auch neue Maßnahmen vorlegen. Seit 2020 müssen sie ihre Klimaschutzziele alle fünf Jahre fortschreiben. Dabei gilt das „Progressionsprinzip“: Nachfolgende Beiträge müssen ehrgeiziger sein als die vorangegangenen. Transparenzregeln sollen sicherstellen, dass die Staaten ihre Verpflichtungen einhalten.
NDC-Partnerschaft
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sind immer an praktische Themen wie Energieversorgung, Stadtentwicklung, Wasser, Verkehr oder Landwirtschaft gebunden. Die Klimaschutzziele der NDCs müssen also mit anderen Entwicklungszielen des Landes in Einklang gebracht und in konkrete Politikansätze, Regelwerke und Investitionspläne übersetzt werden. Um Entwicklungsländer bei dieser Herausforderung zu unterstützen, hat das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) 2016 zusammen mit dem Bundesumweltministerium, der marokkanischen Regierung und der Forschungseinrichtung World Resources Institute (WRI) eine globale „NDC-Partnerschaft“ gegründet. Mehr dazu finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Nationale Menschenrechtsinstitutionen sind staatlich finanzierte, jedoch in ihrer Tätigkeit unabhängige Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie sollen Regierungen und andere staatliche Stellen bei der Umsetzung der internationalen Menschenrechtsabkommen in nationales Recht und bei der Erarbeitung entsprechender politischer Strategien beraten. Außerdem haben sie Kontroll- und Bildungsaufgaben.
Um als nationale Menschenrechtsinstitutionen im Sinne der Pariser Prinzipien (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) anerkannt zu werden, müssen sie ein Akkreditierungsverfahren bei der Globalen Allianz der Nationalen Menschenrechtsinstitutionen (GANHRI (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) durchlaufen. Das Verfahren unterscheidet die Akkreditierungsstufen A und B. A-akkreditierte Institutionen haben Beteiligungsrechte auf UN-Ebene, insbesondere ein Rederecht im UN-Menschenrechtsrat (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Deutschlands nationale Menschenrechtsinstitution ist das Deutsche Institut für Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Naturkatastrophen wie Erdbeben, Wirbelstürme, Dürren oder Überschwemmungen richten vor allem in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) große Schäden an. Aufgrund ihrer Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sind die Betroffenen den Katastrophen oft schutz- und hilflos ausgeliefert. Meistens sind sie nicht in der Lage, die Folgen der Zerstörungen aus eigener Kraft zu überwinden. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) betrachtet Katastrophenvorsorge in besonders gefährdeten Ländern als Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Das Netzwerk zur Bewertung der Leistungsfähigkeit multilateraler Organisationen (Multilateral Organisation Performance Assessment Network, MOPAN) wird von Geberländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) getragen, die gemeinsam die Wirksamkeit multilateraler Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) überprüfen und verbessern wollen. Das Netzwerk begutachtet zu diesem Zweck jährlich verschiedene multilaterale Organisationen und erstellt und veröffentlicht darauf aufbauende Berichte und Empfehlungen.
Mitglieder des Netzwerks sind derzeit neben Deutschland Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Katar, Luxemburg, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Schweden, die Schweiz, Spanien, Südkorea und die USA. Die Europäische Union hat einen Beobachterstatus (Stand: Dezember 2025).
- Externer Link: Website des MOPAN (englisch) (Externer Link)
Mit der New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten (Externer Link) der Vereinten Nationen bekräftigte die Weltgemeinschaft im September 2016 ihren Willen, Verantwortung gegenüber Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten zu übernehmen und hat sich zu einem gemeinsamen Handeln verpflichtet. Die New Yorker Erklärung enthält zwei Anhänge, die den Weg für zwei globale Vereinbarungen geebnet haben:
- den Globalen Pakt für Flüchtlinge (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), der die internationale Zusammenarbeit beim Flüchtlingsschutz fördern soll und
- den Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), der die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Migration verstärken soll.
Das BMZ arbeitet mit zehn Nexus- und Friedenspartnern an strukturellen Ursachen von Konflikten, Flucht und Gewalt und unterstützt sie bei der Friedenssicherung:
Afghanistan*, Irak, Jemen , Demokratische Republik Kongo, Libyen, Somalia, Sudan, Südsudan, Syrien, Tschad
* Die staatliche Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan ist aufgrund der aktuellen Situation zurzeit ausgesetzt.
Nichtregierungsorganisationen (NROs, auf Englisch non-governmental organisations, NGOs) sind prinzipiell alle Verbände oder Gruppen, die gemeinsame Interessen vertreten, nicht gewinnorientiert und nicht von Regierungen oder staatlichen Stellen abhängig sind. Dazu zählen zum Beispiel Gewerkschaften, Kirchen und Bürgerinitiativen, aber auch Arbeitgeberverbände oder Sportvereine. Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich der Begriff NRO besonders für Organisationen, Vereine und Gruppen durchgesetzt, die sich gesellschaftspolitisch engagieren. Einige wichtige und typische Betätigungsfelder von NROs sind Entwicklungspolitik, Umweltpolitik (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Menschenrechtspolitik (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Die OECD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Leitsätze zählen zu den wichtigsten politischen Instrumenten zur Förderung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung. Sie legen unter anderem fest, dass Unternehmen die Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in jedem Land achten sollen, in dem sie ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Sie beschreiben außerdem, was von Unternehmen im Umgang mit Gewerkschaften, im Umweltschutz, bei der Korruptionsbekämpfung und der Wahrung von Verbraucherinteressen erwartet wird.
Externer Link:
Öffentliche Entwicklungsleistungen (englisch: Official Development Assistance, ODA) werden die Mittel genannt, die die Mitglieder des Entwicklungsausschusses (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der OECD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) direkt oder über internationale Organisationen für Entwicklungsvorhaben zur Verfügung stellen, um ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern.
International wurde das Ziel vereinbart, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungsleistungen aufzuwenden. Diese Quote wird derzeit nur von wenigen Ländern erreicht.
Ausführliche Informationen über die deutschen ODA-Leistungen finden Sie hier.
Externer Link:
One Health heißt übersetzt „eine Gesundheit“. Der One-Health-Ansatz beruht auf der Erkenntnis, dass die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt eng miteinander verbunden ist und voneinander abhängt. Entsprechend haben Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur – wie zum Beispiel die Umwandlung von Wald in Weideflächen, der Klimawandel, der Verlust von Biodiversität, Luft- und Meeresverschmutzung – direkte Folgen für die Gesundheit von Menschen und Tieren.
Deutlich wird die enge Verbindung zum Beispiel, wenn Krankheitserreger von Tieren auf Menschen übertragen werden und – durch anschließende Mensch-zu-Mensch-Übertragung – zu Epidemien oder Pandemien führen, wie etwa bei Aids, Ebola und Mpox.
Auch das Problem, dass Mikroorganismen unempfindlich gegenüber der Wirkung von Medikamenten werden (antimikrobielle Resistenzen), geht zum Teil auf Wechselwirkungen zwischen Tieren und Menschen zurück, zum Beispiel durch unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika in der Tierhaltung.
Der One-Health-Ansatz hilft, negative Wechselwirkungen zwischen der Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen zu vermeiden, indem er die fachübergreifende wissenschaftliche und politische Zusammenarbeit fördert. Im Blickpunkt der Entwicklungszusammenarbeit stehen besonders die Schnittstellen zwischen Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährung, Biodiversität, Wasser und Klima.
Wie sich das BMZ für den One-Health-Ansatz engagiert, lesen Sie hier.
Die Organisation der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) für Bildung, Wissenschaft und Kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ist die UN-Sonderorganisation mit dem breitesten Programmspektrum: Durch die Förderung der internationalen Zusammenarbeit in Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Wissenschaft, Kultur und Kommunikation will sie zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit beitragen.
Größtes Aktionsfeld ist die Bildung. Die UNESCO ist für die Steuerung und Fortschrittskontrolle der globalen Bildungsagenda (Education 2030) und damit des vierten Ziels der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zuständig: inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern. Einmal im Jahr veröffentlicht die UNESCO einen Weltbildungsbericht.
Externe Links:
Die Organisation der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) für industrielle Entwicklung (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) wurde 1966 gegründet. In den ersten Jahrzehnten konzentrierte sich die Organisation auf die Industrialisierung der Entwicklungsländer, um das Wohlstandsgefälle zwischen Nord und Süd zu verringern. Heute hilft die UNIDO den Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) hauptsächlich beim Aufbau einer nachhaltigen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und umweltgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.
Informationen über die Zusammenarbeit von BMZ und UNIDO finden Sie hier.
- Externer Link: Website der UNIDO (englisch) (Externer Link)
Die Organisation für Afrikanische Einheit (Organisation of African Unity, OAU) war die Vorläuferorganisation der heutigen Afrikanischen Union (AU) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Nach ihrer Gründung 1963 diente sie den gerade unabhängig gewordenen Staaten Afrikas als wichtiges politisches Forum. Die OAU wurde im Juli 2002 durch die AU ersetzt.
- Externer Link: Website der Afrikanischen Union (englisch) (Externer Link)
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (englisch: Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) gibt es seit 1961. Sie hat ihren Sitz in Paris. Heute sind in der OECD 38 Länder zusammengeschlossen. Gemäß ihrem am 14. Dezember 1960 in Paris unterzeichneten Übereinkommen fördert die OECD eine Politik, die in den Mitgliedsstaaten zu einer optimalen Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung sowie einem steigenden Lebensstandard beiträgt. Sie will dadurch eine gesunde Entwicklung der Weltwirtschaft fördern und im Einklang mit internationalen Verpflichtungen auf multilateraler und nichtdiskriminierender Grundlage zur Ausweitung des Welthandels beitragen.
- Externer Link: Website der OECD (englisch) (Externer Link)
Die Ostafrikanische Gemeinschaft (East African Community, EAC) ist ein Zusammenschluss ostafrikanischer Staaten zur Förderung der regionalen Integration. Die Organisation wurde im Jahr 2000 durch ein Abkommen zwischen Kenia, Tansania und Uganda gegründet. Burundi und Ruanda traten der EAC im Jahr 2007 bei, außerdem wurden Südsudan (2016), die Demokratische Republik Kongo (2022) und Somalia (2024) in die Gemeinschaft aufgenommen.
Die EAC hat das Ziel, die wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Zusammenarbeit ihrer Mitgliedsländer zu erweitern und zu vertiefen. Durch die Schaffung einer Zollunion, eines gemeinsamen Marktes und einer gemeinsamen Währung soll langfristig ein föderaler Staatenbund entstehen. Zu den gemeinsamen Institutionen gehören auch der Gerichtshof (East African Court of Justice) zur Überwachung der Verträge und die parlamentarische Versammlung (East African Legislative Assembly) als demokratisch legitimiertes Gesetzgebungs- und Kontrollorgan.
Der englische Begriff Ownership bedeutet wörtlich übersetzt „Eigentümerschaft“. Er wird in der entwicklungspolitischen Diskussion verwendet, um die Identifikation der Menschen mit einem sie betreffenden Vorhaben zu umschreiben. Ownership ist auch die Eigenverantwortung, die Zielgruppen und Partnerorganisationen bei der Entwicklungszusammenarbeit übernehmen. Sie gilt als wichtige Vorbedingung für die Effizienz, die Nachhaltigkeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und den Erfolg von Maßnahmen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Im „Pariser Club“ haben sich bereits 1956 wichtige staatliche Gläubiger zusammengeschlossen, um bei Zahlungsschwierigkeiten von Schuldnerländern koordinierte Lösungen zu finden. Notwendige Voraussetzung für Umschuldungsvereinbarungen im Pariser Club ist die erfolgreiche Durchführung von Anpassungsprogrammen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Verbindliche Vereinbarungen für die Gestaltung des makroökonomischen und des finanzpolitischen Rahmens sowie institutionelle Veränderungen sollen die jeweilige Volkswirtschaft wieder auf ein tragfähiges Fundament stellen. Seit Gründung des Pariser Clubs hat sich die Gläubigerlandschaft stark verändert. Viele wichtiger werdende Gläubigerstaaten (wie China) sind bislang keine Mitglieder des Pariser Clubs.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Die 1993 von der UN-Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verabschiedeten Pariser Prinzipien empfehlen den Mitgliedsstaaten, nationale Institutionen für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) einzurichten. Aufgaben und Arbeitsweise dieser Einrichtungen werden in der Resolution beschrieben. Die Institutionen sollen über eine sichere rechtliche Grundlage, einen klaren Auftrag sowie über eine ausreichende Infrastruktur und Finanzierung verfügen. Sie sollen die Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und alle mit Menschenrechten befassten Berufsgruppen einbinden und völlig unabhängig von der Regierung arbeiten.
Die Einhaltung der Prinzipien wird durch die Globale Allianz der Nationalen Menschenrechtsinstitutionen (GANHRI (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) überwacht.
Deutschlands nationale Menschenrechtsinstitution ist das Deutsche Institut für Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Externer Link:
Der Begriff Partizipation geht auf das lateinische Wort „particeps“ (= „teilnehmend“) zurück und steht für Beteiligung, Teilhabe, Mitwirkung oder Einbeziehung.
Partizipation ist ein wichtiges Gestaltungsprinzip der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie bedeutet, dass sich Menschen (Bevölkerungsgruppen, Organisationen, Verbände, Parteien) aktiv und maßgeblich an allen Entscheidungen beteiligen, die ihr Leben beeinflussen. Partizipation trägt dazu bei, dass die Zielgruppen und Partnerorganisationen der Entwicklungszusammenarbeit ihre Interessen artikulieren und durchsetzen können (Empowerment (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)).
Partizipation bedeutet außerdem, dass die Menschen ihre Erfahrungen und Wertvorstellungen in die gemeinsame Arbeit einbringen. Dadurch machen sie sich die Vorhaben zu eigen und übernehmen die Verantwortung für ihren Erfolg (Ownership (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)).
Das Permanente Komitee für Dürrekontrolle im Sahel (Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel, CILSS) koordiniert die Bemühungen von 13 Staaten bei der Bekämpfung der Desertifikation (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der Herstellung eines neuen ökologischen Gleichgewichts in der Sahelzone. Das Komitee beschäftigt sich als regionales Kompetenzzentrum zudem mit übergreifenden entwicklungspolitischen Themen wie der Armutsbekämpfung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), der Ernährungssicherung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und dem Management natürlicher Ressourcen.
Dem Komitee gehören Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien, Niger, Senegal, Togo und der Tschad an.
- Externer Link: Website des CILSS (französisch) (Externer Link)
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist das nationale Metrologie-Institut Deutschlands und beschäftigt sich mit der Lehre von Maßen, Gewichten und Maßsystemen. Die PTB führt im Auftrag des BMZ Projekte der technischen Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) durch. Arbeitsbereiche sind zum Beispiel das Mess-, Normen-, Prüf- und Qualitätswesen. So unterstützt die PTB Schwellen- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)dabei, eine international anerkannte Qualitätsinfrastruktur auf- und auszubauen. Moderne Messtechniken werden unter anderem für einen freien und fairen Handel, ein zuverlässiges Gesundheitswesen, den Schutz der Umwelt und den Ausbau erneuerbarer Energien benötigt.
- Externer Link: Website der PTB (Externer Link)
Um Hunger (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Mangelernährung weltweit wirksam zu bekämpfen, braucht es öffentliche und private Investitionen in die Land- und Nahrungsmittelwirtschaft. Im Herbst 2014 verabschiedeten die Mitgliedsstaaten des Ausschusses für Welternährungssicherheit der FAO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Prinzipien für verantwortliche Investitionen in die Landwirtschaft und Nahrungsmittelsysteme (Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems). Sie sollen sicherstellen, dass solche Investitionen auch tatsächlich der Bevölkerung in den Entwicklungs- und Schwellenländern zugutekommen. Unter anderem sehen die zehn Leitlinien vor, dass Agrarinvestoren bestehende Rechte auf Land und die damit verbundenen natürlichen Ressourcen anerkennen und respektieren und alle Betroffenen in Verhandlungen einbeziehen müssen.
Externer Link:
Die private Wirtschaft ist oft der dynamischste Bereich einer Volkswirtschaft. Neue Arbeitsplätze entstehen fast ausschließlich in privaten Unternehmen und diese haben entscheidenden Einfluss auf die Arbeits-, Produktions- und Konsumbedingungen in einem Land. Die Stärkung der Privatwirtschaft in Entwicklungs- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Schwellenländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist deshalb ein wichtiges Ziel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Dazu strebt die Bundesregierung unter anderem eine enge Kooperation mit der deutschen und europäischen Privatwirtschaft an, zum Beispiel in Form von öffentlich-privaten Entwicklungspartnerschaften (Public Private Partnerships, PPP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)).
Durch Kooperation mit der Privatwirtschaft kann zusätzliches Know-how und Geld für die Entwicklungszusammenarbeit gewonnen werden. Das Engagement und die Gestaltungskraft privater Unternehmen wirken auch in Bereichen, die der Staat aus politischen, ökonomischen oder logistischen Gründen kaum erreichen kann. Die deutsche Bundesregierung arbeitet darum auf verschiedenen entwicklungspolitischen Ebenen intensiv und sehr erfolgreich mit der privaten Wirtschaft zusammen.
Ausführliche Informationen über die deutsche entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Programm der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) für menschliche Siedlungen (United Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT) ist innerhalb des UN-Systems die zentrale Organisation für Stadtentwicklung , Siedlungswesen und Wohnungsversorgung in Entwicklungs- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Transformationsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie hat das Ziel, eine nachhaltige (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) städtische Entwicklung zu fördern. Die Organisation hat ihren Sitz in Nairobi (Kenia).
- Externer Link: Website von UN-HABITAT (englisch) (Externer Link)
Die Public-Private Infrastructure Advisory Facility (Beratungseinrichtung für öffentlich-private Infrastruktur, PPIAF) ist ein internationaler Treuhandfonds, der von der Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verwaltet wird. Er unterstützt Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) durch Zuschüsse für Beratung, Training und Forschung im Bereich der privaten Infrastrukturfinanzierung. Das Ziel ist, die Rahmenbedingungen für private Beteiligungen an der Infrastruktur in Entwicklungsländern zu verbessern. Deutschland leistet finanzielle Beiträge zum Fonds.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Public Private Partnerships (öffentlich-private Partnerschaften, PPP) sind Kooperationen von öffentlicher Hand und privater Wirtschaft beim Entwerfen, bei der Planung, Erstellung, Finanzierung, dem Management, dem Betreiben und dem Verwerten von zuvor allein in staatlicher Verantwortung erbrachten öffentlichen Leistungen. Öffentliche-private Partnerschaften stellen somit eine Beschaffungsalternative des Staates zur herkömmlichen Eigenrealisierung dar.
In der Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) besteht zudem mit den sogenannten Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft (EPW) eine spezielle Form der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Dies sind kurz- bis mittelfristig angelegte gemeinsame Vorhaben von Unternehmen und Durchführungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Entwicklungszusammenarbeit im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)).
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) hat sechs Qualitätsmerkmale für eine werteorientierte, nachhaltige (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und zukunftsorientierte Entwicklungszusammenarbeit festgelegt. Sie dienen als Gütesiegel der deutschen Entwicklungspolitik und müssen bei allen Aktivitäten des BMZ und seiner Durchführungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) berücksichtigt werden:
- Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Geschlechtergleichstellung und Inklusion
- Anti-Korruption und Integrität
- Armutsbekämpfung und Reduzierung der Ungleichheit
- Umwelt- und Klimaprüfung
- Konfliktsensibilität (Do-no-harm-Prinzip (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen))
- Digitalisierung
Der Rat der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (auch kurz „Rat“ oder „Ministerrat“ genannt) ist zusammen mit dem Europäischen Parlament (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) als Gesetzgeber tätig und entscheidet gemeinsam mit ihm über den EU-Haushalt. Außerdem legt er die Grundzüge der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fest und schließt internationale Übereinkünfte zwischen der EU und anderen Staaten ab. Der Rat ist ebenfalls an der Abstimmung der Wirtschaftspolitik in den Mitgliedsstaaten und der Zusammenarbeit der nationalen Gerichte und der Sicherheitsorgane beteiligt.
Der Rat wurde in den 1950er Jahren durch die Gründungsverträge eingesetzt. In ihm sind die EU-Mitgliedsstaaten vertreten. An seinen Tagungen nimmt je eine Ministerin beziehungsweise ein Minister aus den nationalen Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten teil. Der Rat tagt in verschiedenen Zusammensetzungen, die von den zu behandelnden Themen abhängen, zum Beispiel auswärtige Angelegenheiten, Wirtschaft und Finanzen oder Umwelt. Den Vorsitz (EU-Ratspräsidentschaft) übernehmen die EU-Mitgliedsstaaten im Wechsel jeweils für ein halbes Jahr.
Rat für Auswärtige Angelegenheiten
Die Beziehungen der EU zu Drittländern werden vom Rat für Auswärtige Angelegenheiten behandelt. Er ist für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, den Außenhandel sowie die Entwicklungszusammenarbeit zuständig.
Die Entwicklungsministerinnen und -minister aller Mitgliedsstaaten tagen halbjährlich und legen die Grundsätze der europäischen Entwicklungspolitik fest. Die Entscheidungen werden in Arbeitsgruppen vorbereitet.
Dem Rat für Auswärtige Angelegenheiten steht seit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags (2009) nicht mehr die EU-Ratspräsidentschaft vor, sondern die Hohe Vertreterin der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Arbeitsgruppe zur Entwicklungszusammenarbeit
In der Ratsarbeitsgruppe „Entwicklungszusammenarbeit und internationale Partnerschaften“ (CODEV-PI) erörtert Deutschland mit den anderen Mitgliedsstaaten die politischen Grundsätze, Ziele und Vorgehensweisen der europäischen Entwicklungspolitik.
Die Gruppe erarbeitet die strategischen Leitlinien zur wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung und zur Armutsbeseitigung und koordiniert die Entwicklungspolitik der Mitgliedsstaaten. Sie bearbeitet gemeinsame Verpflichtungen im Rahmen internationaler Gremien und Abkommen und beschließt entwicklungspolitische Maßnahmen, die auf europäischer Ebene umgesetzt werden müssen. Auch die politische Steuerung des europäischen Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI-GE) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) übernimmt diese Ratsarbeitsgruppe.
Rechtsakte
Für die Annahme von Rechtsakten (Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen, Stellungnahmen) ist im Rat in der Regel eine qualifizierte Mehrheit erforderlich: Zustimmen müssen 55 Prozent aller Länder, die außerdem mindestens 65 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung stellen müssen.
Um einen Rechtsakt zu verhindern, sind in der Regel mindestens vier Länder erforderlich, die mindestens 35 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung stellen. Ausnahmen bilden besonders sensible Angelegenheiten wie Außenpolitik und Steuern. Hier ist in der Regel Einstimmigkeit erforderlich. Für rein verfahrenstechnische und administrative Angelegenheiten genügt die einfache Mehrheit.
Externe Links:
Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass Regierung und Verwaltung nur im Rahmen bestehender Gesetze handeln dürfen. Die Bürgerinnen und Bürger werden so vor staatlicher Willkür, Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen geschützt. Rechtsstaatlichkeit ist Voraussetzung für Frieden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Freiheit und nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Sie ist die Grundlage einer funktionierenden Demokratie (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und ein zentrales Element von guter Regierungsführung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Deutschland fordert und fördert deshalb im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) den Auf- und Ausbau rechtsstaatlicher Strukturen in seinen Partnerländern.
Ausführliche Informationen über entwicklungspolitische Ansätze zur Förderung von Rechtsstaatlichkeit finden Sie hier.
Etwa elf Prozent der globalen Treibhausgasemissionen gehen auf Entwaldung zurück – durch die Zerstörung von Wäldern wird der in ihnen gebundene Kohlenstoff freigesetzt. Wälder haben also, neben zahlreichen anderen Funktionen, auch eine große Bedeutung für den Klimaschutz. Auf der 11. UN-Klimarahmenkonferenz 2005 in Montreal wurde daher ein Mechanismus vorgeschlagen, der Entwicklungsländern finanzielle Anreize bietet, Entwaldung zu vermeiden und damit klimaschädliche Kohlendioxidemissionen zu verringern.
Bei der Folgekonferenz auf Bali 2007 wurde beschlossen, diese Maßnahmen unter dem Namen REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, deutsch: Minderung von Emissionen aus Entwaldung und Schädigung von Wäldern) zusammenzufassen. In den folgenden Jahren wurde der REDD-Mechanismus weiterentwickelt und es wurden auch Maßnahmen eingeschlossen, die beispielsweise der Aufforstung von Wäldern sowie der nachhaltigen Waldbewirtschaftung dienen. Diese erweiterten Maßnahmen laufen unter der Bezeichnung REDD+.
Die regionalen Entwicklungsbanken sind nach dem Modell der Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) aufgebaut. Anders als bei der Weltbank liegt die Mehrheit der Kapitalanteile jedoch bei den regionalen Mitgliedsstaaten. Die regionalen Entwicklungsbanken, ihre Sonderfonds und Spezialinstitute finanzieren nur Projekte und Programme in den jeweiligen Mitgliedsländern ihrer Region. Ihr Hauptziel ist die Bekämpfung der Armut.
Für die Zusammenarbeit der Bundesrepublik mit der Afrikanischen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Inter-Amerikanischen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Asiatischen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der Karibischen Entwicklungsbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist das BMZ federführend. Für die Zusammenarbeit mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist das Bundesfinanzministerium zuständig.
Der Begriff der Resilienz wird in verschiedenen Wissenschaften benutzt, unter anderem in der Physik, in der Soziologie und der Medizin. In der Materialkunde bezeichnet er Stoffe, die auch nach extremer Spannung wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehren. Übersetzt wird er häufig als „Widerstandsfähigkeit“.
Bezogen auf den Menschen beschreibt Resilienz die Fähigkeit von Personen oder Gemeinschaften, schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Katastrophen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen. Resilienz in Bezug auf den Klimawandel bedeutet zum Beispiel, dass der Mensch lernt, mit den Risiken und Folgen der globalen Erwärmung zu leben, sein Verhalten daran anzupassen und künftigen Krisen vorzubeugen.
Nicht resiliente Menschen und Gesellschaften werden häufig als vulnerabel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bezeichnet.
Der sogenannte Ressourcenansatz dient der Bewertung von Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und ist einkommensbasiert: Laut Definition der Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sind alle Menschen absolut oder extrem arm, die weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Bei diesem Ansatz, der heute allgemein anerkannt ist, wird die Kaufkraft des US-Dollars in lokale Kaufkraft umgerechnet. Das heißt, dass absolut arme Menschen nicht in der Lage sind, sich täglich die Menge an Gütern zu kaufen, die in den USA 2,15 US-Dollar kosten würden. Die 2,15-Dollar-Grenze wird als finanzielles Minimum angesehen, das eine Person zum Überleben braucht. Durch die Umrechnung in lokale Kaufkraft können die Armutsquoten international verglichen werden.
Das könnte Sie auch interessieren:
Bei einem revolvierenden („sich wiederholenden“) Kredit kann der Kreditnehmer während eines bestimmten Zeitraums mehrmals Geld erhalten und wieder zurückzahlen. Der Kredit lässt sich je nach Bedarf beliebig oft abrufen, bis zu einer vorab vereinbarten maximalen Höhe. Erst am Ende der Kreditlaufzeit muss der Kreditnehmer das gesamte Geld inklusive Zinsen wieder zurückgezahlt haben.
20 Jahre nach der ersten Rio-Konferenz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), bei der 1992 wichtige Grundlagen zum Umwelt- und Ressourcenschutz beschlossen worden waren, fand die dritte Nachfolgekonferenz („Rio 2012“) als „UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung“ erneut in Rio de Janeiro statt. Im Kern widmete sie sich zwei Themenschwerpunkten: der Entwicklung einer ökologischen Wirtschaftsweise („Green Economy“) sowie der Schaffung der notwendigen institutionellen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Das BMZ beteiligte sich gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium aktiv an der politischen und inhaltlichen Vorbereitung dieser Konferenz.
Die Nutzung mineralischer Rohstoffe ist eine der wesentlichen Grundlagen moderner industrieller Gesellschaften. Die stark gestiegene Rohstoffnachfrage auf den Weltmärkten seit 2004 hatte auch eine Neubewertung der entwicklungspolitischen Bedeutung von Rohstoffen zur Folge. Ihr Rohstoffreichtum bietet vielen Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Chancen, die eigene Wirtschaft nachhaltig (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu entwickeln und zu Wohlstand zu kommen. Doch der Rohstoffreichtum birgt auch Risiken für die Umwelt, kann Korruption (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) fördern oder sogar bewaffnete Konflikte oder Finanzkrisen auslösen.
Ein wesentlicher Schlüssel für die Entwicklung eines leistungsfähigen, nachhaltigen Rohstoffsektors ist der Aufbau eines tragfähigen gesetzlichen Rahmens, leistungsfähiger Verwaltungs- und Aufsichtsbehörden und die Einrichtung transparenter Verfahren von der Konzessionsvergabe über die Regelung der Abgaben bis zum Handel.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) versteht sich als Institution politischer Bildung, als Forum für den Dialog zwischen linkssozialistischen Kräften, sozialen Bewegungen, linken Intellektuellen und Nichtregierungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und als Forschungsstätte für eine progressive Gesellschaftsentwicklung. Die Stiftung wurde 1992 von der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS, heute: Die LINKE) als parteinahe, bundesweit tätige Stiftung anerkannt.
In ihrer internationalen Arbeit setzt sich die Rosa-Luxemburg-Stiftung insbesondere für Frieden und Völkerverständigung, die Durchsetzung von demokratischen und sozialen Rechten für alle Menschen, eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Weltwirtschaftsordnung und für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein.
- Externer Link: Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung (Externer Link)
Das Samoa-Abkommen regelt die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und den Staaten in Afrika, in der Karibik und im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Das Partnerschaftsabkommen wurde im November 2023 von der EU und ihren Mitgliedsstaaten sowie den Mitgliedern der Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten (OACPS) unterzeichnet. Es führt die Tradition der Partnerschaftsabkommen von Yaoundé (1965 bis 1975), Lomé (1975 bis 2000) und Cotonou (2000 bis 2023) fort.
Das Samoa-Abkommen ist auf 20 Jahre angelegt und verbindet die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit verstärkter regionaler Kooperation. Hauptziel ist eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen der EU und den 79 AKP-Staaten sowie die Umsetzung der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und des Pariser Klimaabkommens (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Schwerpunktthemen der Kooperation sind:
- Demokratie und Menschenrechte
- nachhaltiges Wirtschaftswachstum und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
- Klimawandel
- menschliche und soziale Entwicklung
- Frieden und Sicherheit
- Migration und Mobilität
Externer Link:
Das Schenkungsäquivalent ist ein rechnerischer Wert, der die Vergünstigung eines zinsverbilligten Darlehens gegenüber Marktkonditionen angibt. Dieser errechnet sich auf Basis des jeweiligen Schenkungselements (Prozentsatz, der die Konzessionalität des Darlehens angibt), der Höhe der Marktmittel und der Rio-Marker der jeweiligen Vorhaben. Dies entspricht den für die ODA (Official Development Assistance) im Rahmen des Entwicklungsausschusses der OECD (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (DAC) abgestimmten Regularien.
Eine exakte, international gültige Definition des Begriffs „Schwellenland“ gibt es nicht. Schwellenländer werden meist den Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zugeordnet. Typisch für sie ist, dass sie sich in einem umfassenden Wandlungsprozess befinden und häufig ein überdurchschnittliches Wachstum der wirtschaftlichen Leistung und des Pro-Kopf-Einkommens aufweisen. Die soziale Entwicklung kann in vielen Schwellenländern allerdings noch nicht mit dem wirtschaftlichen Wachstum mithalten. Das zeigt sich zum Beispiel bei der durchschnittlichen Lebenserwartung, der Säuglingssterblichkeit, dem Bildungsniveau oder bei Zugang zu Energie- und Wasserversorgung. Das rasante Wachstum wird zudem häufig von einer zunehmenden Ungleichheit bei den Einkommen begleitet.
In den vergangenen Jahrzehnten sind Schwellenländer wie Brasilien, China und Indien zu wichtigen politischen und wirtschaftlichen Akteuren aufgestiegen. Verstärkt und zu Recht fordern sie, auf globaler Ebene mehr Gehör zu finden und eine aktivere Rolle in den internationalen Organisationen zu spielen. Eine weltweite nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der Schutz globaler öffentlicher Güter wie Frieden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Sicherheit sowie eine intakte Umwelt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) können nur gemeinsam mit diesen Ländern erreicht werden. Für die Entwicklungspolitik sind die Schwellenländer deshalb wichtige Partner.
Im Februar 2023 veröffentlichten die Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) den „SDG-Stimulus zur Umsetzung der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)“. Die Initiative des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres sieht vor, das globale Finanzsystem gerechter zu gestalten sowie Schulden umzustrukturieren, um hochverschuldeten Ländern finanzielle Spielräume zu eröffnen.
Außerdem rufen die Vereinten Nationen dazu auf, die nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) auch finanziell stärker zu unterstützen. Um die finanzielle Kluft zwischen dem Globalen Süden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und dem Globalen Norden zu schließen, müsse die Kreditvergabe der multilateralen Entwicklungsbanken deutlich ausgeweitet werden. Der SDG-Stimulus ruft auf, eine Reihe an Maßnahmen umzusetzen, die jährlich mindestens 500 Milliarden US-Dollar für nachhaltige Entwicklungsfinanzierung mobilisieren sollen.
Mit der Initiative reagieren die Vereinten Nationen auf die zahlreichen Krisen, die die erfolgreiche Umsetzung der Agenda 2030 gefährden. Dazu zählen die Corona-Pandemie, der Klimawandel, der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und die steigende Schuldenlast vieler Länder.
Sustainable Development Goals, siehe Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Das Seminar für ländliche Entwicklung (SLE) an der Humboldt-Universität Berlin wurde 1962 gegründet. Das Angebot des Seminars umfasst ein Aufbaustudium, Fortbildungskurse für internationale Fachkräfte, anwendungsorientierte Forschung sowie Beratung von entwicklungspolitischen Organisationen und Universitäten. Im Mittelpunkt des SLE steht das zwölfmonatige Ergänzungsstudium „Internationale Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung“, in dem insbesondere Methoden und Instrumente der ländlichen Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gelehrt werden. Ein wichtiges Element dieser spezialisierten Ausbildung ist ein dreimonatiger Auslandseinsatz, in dem entwicklungspolitische Zusammenhänge praktisch vermittelt werden. Die Absolventinnen und Absolventen werden dadurch auf eine qualifizierte Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) vorbereitet.
Externer Link:
Das Sendai-Rahmenwerk für Katastrophenvorsorge 2015–2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030) wurde im März 2015 auf der dritten Weltkonferenz zur Reduzierung von Katastrophenrisiken im japanischen Sendai verabschiedet. Das Dokument bildet eine Handlungsgrundlage für Staaten und Zivilgesellschaften (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) weltweit. Bis zum Jahr 2030 sollen Katastrophenrisiken verringert, die Entstehung neuer Risiken vermieden und die Widerstandsfähigkeit von Bevölkerung und Institutionen gegenüber Katastrophen erhöht werden.
In dem Rahmenwerk werden sieben verbindliche Ziele formuliert:
- Die weltweite Zahl der Todesopfer durch Katastrophen erheblich senken
- Die Zahl der von Katastrophen betroffenen Menschen deutlich senken
- Die volkswirtschaftlichen Katastrophenschäden mindern
- Die Katastrophenschäden an wichtiger Infrastruktur und Störungen der Grundversorgung, etwa im Gesundheits- und Bildungswesen, verringern
- Die Zahl der Länder mit nationalen und lokalen Strategien zur Reduzierung von Katastrophenrisiken deutlich erhöhen
- Die internationale Zusammenarbeit und Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Umsetzung nationaler Aktivitäten wesentlich verbessern
- Den Zugang zu Frühwarnsystemen sowie zu Informationen über und Bewertungen von Katastrophenrisiken verbessern
2017 richtete die UN-Generalversammlung mit dem Sendai Framework Monitor ein Kontrollsystem ein, das die Fortschritte in der Umsetzung des Rahmenwerks überwachen und dokumentieren soll.
Externe Links:
- Sendai-Rahmenwerk für Katastrophenvorsorge 2015–2030 (PDF 285 KB) (Externer Link)
- Sendai Framework Monitor (englisch) (Externer Link)
Das könnte Sie auch interessieren:
Der Senior Expert Service (SES) ist als Stiftung der deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit die führende deutsche Entsendeorganisation für ehrenamtliche Fach- und Führungskräfte im Ruhestand. Er wurde 1983 gegründet. Seit 2017 können im Rahmen des Freiwilligendienstes „Weltdienst 30+“ auch Berufstätige ab 30 Jahre ihr Fachwissen in Entwicklungs- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Schwellenländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) weitergeben.
Alle SES-Einsätze folgen dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Schwerpunkt ist die Lösung akuter technischer oder betriebswirtschaftlicher Probleme in kleinen und mittleren Unternehmen. Auftraggeber sind aber auch öffentliche Einrichtungen, Kommunen und gemeinnützige Träger.
Ein SES-Einsatz dauert im Schnitt vier bis sechs Wochen, längstens jedoch sechs Monate. Grundsätzlich wird erwartet, dass der Auftraggeber im Partnerland die Kosten für den Einsatz übernimmt. Ist er dazu nicht in der Lage, kann ein Teil der Kosten aus BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Mitteln finanziert werden.
- Externer Link: Website des SES (Externer Link)
Die sequa gGmbH ist eine weltweit tätige Entwicklungsorganisation mit Sitz in Bonn. Die 1991 gegründete gemeinnützige Gesellschaft verbindet das Know-how der Wirtschaft mit den Erfahrungen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Gesellschafter sind die vier Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Bundesverband der deutschen Industrie, Zentralverband des Deutschen Handwerks, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände) sowie die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Wichtigste Kunden sind das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und die Europäische Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Die sequa übernimmt Aufgaben wie Programmverwaltung, Projektmanagement sowie Beratungsleistungen in ihren Geschäftsfeldern Kammern und Verbände, berufliche Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Handel. Die Organisation fördert unter anderem den Aufbau von Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Kammern und Verbände werden dabei unterstützt, die Interessen der Privatwirtschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu vertreten und eine aktive Rolle in der lokalen Wirtschaftsentwicklung zu übernehmen.
- Externer Link: Website der sequa (Externer Link)
Der Fachbegriff „sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRGR)“ beschreibt das uneingeschränkte körperliche und seelische Wohlbefinden in Bezug auf alle Bereiche der Sexualität und Fortpflanzung des Menschen. Zu den entwicklungspolitischen Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Rechte zählen zum Beispiel Sexualaufklärung, HIV (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Prävention, Familienplanung, die Versorgung bei Schwangerschaft und Geburt, die Vorbeugung und Behandlung sexuell übertragbarer Krankheiten sowie die Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt, etwa der Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen.
Ausführliche Informationen zu den BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Aktivitäten im Bereich der körperlichen Selbstbestimmung und sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Beim „sozialen Marketing“ wird mit Methoden der kommerziellen Werbung für nicht-kommerzielle Anliegen geworben, um einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel und eine Veränderung von Verhaltensweisen zu erreichen. In der Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) wird Social Marketing zum Beispiel im Bereich Familienplanung und Aids (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Prävention eingesetzt, um die Bevölkerung eines Landes zur Nutzung von Kondomen zu motivieren. Durch Fernseh- und Radiowerbung, Plakate, Handzettel und Straßentheater werden die Menschen über Anwendung und Wirkung informiert. Die finanzielle Unterstützung von Social-Marketing-Programmen ermöglicht es, den Zugang zu den beworbenen Produkten zu erweitern, also die Zielgruppe zum Beispiel mit guten und gleichzeitig bezahlbaren Verhütungsmitteln zu versorgen. Auf Dauer sollen die Programme dann ohne weitere finanzielle Unterstützung auskommen können.
Soziale Sicherung ist die Absicherung gegen den Eintritt von Risiken wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Altersarmut oder Ernteausfall. In vielen Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sind traditionelle Solidargemeinschaften, in erster Linie die Familien, die einzige Form sozialer Absicherung. Soziale Sicherungssysteme – wie etwa Kranken- und Rentenversicherungen, Sozialtransferprogramme für extrem Arme oder Mikroversicherungen – sind wichtige Instrumente für eine erfolgreiche Verringerung der Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Deutschland engagiert sich deshalb in vielen Entwicklungsländern für den Auf- und Ausbau sozialer Sicherungssysteme. Leitbild ist dabei die Entwicklung eines Systems, das menschenrechtlichen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Kriterien folgt und allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu unterschiedlichen Formen der Absicherung garantiert.
Mehr zum Thema finden Sie hier.
Als Sozialstandards können sowohl gesetzliche Regelungen als auch sämtliche Übereinkommen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen betrachtet werden, die auf die Verbesserung der Situation der Beschäftigten abzielen. Sie reichen von tarifvertraglich festgelegten Löhnen und Urlaubsregelungen über Gesetze zur Sozialversicherungspflicht bis zu Vorschriften über Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz.
Sozialstandards sind grundlegende Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dazu gehören auch die sogenannten Kernarbeitsnormen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen): das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit, die Vereinigungsfreiheit, das Recht, Gewerkschaften zu gründen, das Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit von Frauen und Männern und die Beseitigung von Diskriminierung im Arbeitsleben.
Um sich kurzfristig Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, werden in manchen Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) die Sozialstandards missachtet. Deutschland setzt sich für die weltweite Durchsetzung dieser Standards ein, denn ihre Einhaltung ist ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)und zur Minderung der Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Viele Unternehmen haben inzwischen festgestellt, dass Sozialstandards auch ein Wettbewerbsvorteil sein können.
Das könnte Sie auch interessieren:
Sozialstrukturträger sind Nichtregierungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die über Fähigkeiten und Erfahrungen beim Aufbau und der Förderung sozialer Strukturen verfügen. In der Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) hat die Arbeit von Sozialstrukturträgern das Ziel, Selbsthilfe und Eigeninitiative der Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu stärken sowie die Teilhabe benachteiligter Bevölkerungsgruppen an sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen ihres Landes zu fördern.
Das BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) fördert aktuell die weltweite Arbeit von folgenden Sozialstrukturträgern:
- Arbeiterwohlfahrt (AWO International (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen))
- Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Bremer Arbeitsgemeinschaft für Überseeforschung und Entwicklung (BORDA (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen))
- Christoffel-Blindenmission (Externer Link)
- Deutscher Caritasverband (Caritas international (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen))
- Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Deutsches Rotes Kreuz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Don Bosco Mondo (Externer Link)
- Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV International (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen))
- Malteser International (Externer Link)
- Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes (Kolping International (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen))
- Welthungerhilfe (Externer Link)
Tätigkeitsbereiche dieser Fachorganisationen sind unter anderem Erwachsenenbildung, Genossenschaftsförderung, gewerkschaftliche Bildung, Kleinkreditwesen, sanitäre Grundversorgung, Sozialarbeit, Gemeinwesenentwicklung und Organisationsentwicklung.
Seit 2008 lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten – Tendenz steigend: Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass im Jahr 2050 mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung in städtischen Zentren leben werden. Besonders schnell wachsen die Städte in Entwicklungs- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Schwellenländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in Asien und Afrika. Nach aktuellen Berechnungen wird sich die urbane Bevölkerung in den afrikanischen Staaten südlich der Sahara innerhalb weniger Jahrzehnte nahezu verdreifachen.
Zu den Folgen der Urbanisierung zählen Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und soziale Ungleichheit, Nahrungsengpässe, fehlender Zugang zur Wasser- (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Sanitär- und Gesundheitsversorgung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), mangelnde Beteiligungsmöglichkeiten am politischen und wirtschaftlichen Leben, die Missachtung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie ein steigender Ressourcenverbrauch und Kohlendioxidausstoß. Doch die Städte können auch einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) globalen Entwicklung leisten. Sie sind Zentren für wirtschaftliches Wachstum, Innovation, Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Beschäftigung, für lokale Selbstbestimmung, zivilgesellschaftliche (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und politische Entwicklung. Somit spielen sie eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und des Klimaabkommens von Paris (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) greift diese Potenziale auf und unterstützt die Partnerländer bei der Schaffung förderlicher Rahmenbedingungen (gute lokale Regierungsführung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), partizipative (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Stadtentwicklung, Stärkung kommunaler Finanzen). Gefördert werden außerdem Schlüsselbereiche der Stadtentwicklung, etwa die Infrastruktur zur Grundversorgung der Bevölkerung, Ansätze der Kreislaufwirtschaft sowie eine am Gemeinwohl orientierte Digitalisierung.
Mehr über das entwicklungspolitische Engagement Deutschlands für eine nachhaltige Stadtentwicklung lesen Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
PRSP ist die Abkürzung für „Poverty Reduction Strategy Paper“, deutsch: Strategiepapier zur Armutsminderung. Das Konzept der PRSPs haben Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und IWF (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) als umfassenden Ansatz zur Armutsbekämpfung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) entwickelt und 1999 vorgestellt. Ziel des Konzepts ist es, die Politik der beiden Institutionen gegenüber den ärmsten Ländern ganz auf das Ziel der Armutsminderung auszurichten. Die Idee der PRSPs basiert darauf, dass die ärmeren Länder selbst Strategien für die Entwicklung ihrer Wirtschaft und ihres Sozialsystems entwickeln und die Verantwortung für die Umsetzung übernehmen. Die Geberländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) unterstützen diese Strategien.
PRSPs sollen in einem partizipativen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Prozess entstehen, das heißt, dass auch die Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sich an ihrer Erarbeitung beteiligt: Gewerkschaften, Unternehmerverbände, Kirchen, Nichtregierungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Genossenschaften und Basisgruppen. Die PRSPs umfassen wirtschaftspolitische, finanzielle und soziale Aspekte. Sie sollen kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Die Vorlage eines Strategiepapiers zur Armutsminderung ist Voraussetzung für die Teilnahme an einigen Kreditprogrammen des IWF und auch für einen Schuldenerlass im Rahmen der HIPC-Initiative (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Nach EU-weit geltendem Recht können Menschen aus Krisengebieten, die keine Aussicht auf Asyl oder Anerkennung als Flüchtling (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) haben, unter „subsidiären Schutz“ gestellt werden, wenn ihnen in ihrem Herkunftsland ein „ernsthafter Schaden“ droht – also zum Beispiel die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder willkürliche Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.
Das Sustainable Development Solutions Network (SDSN, frei übersetzt: Netzwerk für Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung) ist ein globales Wissenschaftsnetzwerk. Es wurde 2012 unter der Schirmherrschaft des UN-Generalsekretärs ins Leben gerufen. Durch Forschung, politische Analysen und globale Zusammenarbeit fördert es integrierte Ansätze zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und des Pariser Klimaabkommens (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Dazu dokumentiert das SDSN unter anderem die Fortschritte von Ländern beim Erreichen der einzelnen SDGs. Dies erfolgt in Form eines jährlichen Berichts (Externer Link), des Sustainable Development Reports (Bericht über nachhaltige Entwicklung) und durch das SDG-Dashboard (Externer Link), einer Visualisierung der SDG-Fortschritte. Darüber hinaus werden Daten zu einzelnen Ländern und Regionen veröffentlich. Die Daten stammen aus frei zugänglichen Quellen, zum Beispiel von der Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), der Weltgesundheitsorganisatin (WHO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und anderen Organisationen.
- Externer Link: Website des SDSN (englisch) (Externer Link)
Der Team-Europe-Ansatz wurde 2020 von der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ins Leben gerufen. Ursprüngliches Ziel war, die Partnerländer der EU bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen. Im Verlauf der Pandemie hat sich Team Europe zu einem übergreifenden Ansatz der gemeinsamen europäischen Außen- und Entwicklungspolitik weiterentwickelt.
Der Ansatz bündelt erstmals die entwicklungspolitischen Beiträge der Europäischen Kommission (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie der EU-Mitgliedsstaaten und europäischen Finanzinstitutionen (Europäische Investitionsbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Somit trägt er dazu bei, die Führungsrolle, Verantwortung und Solidarität der EU auf der globalen Bühne herauszustellen und gemeinsame Werte und Interessen stärker ins Blickfeld zu rücken.
Im Rahmen der gemeinsamen Programmplanung (Joint Programming (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) verzahnen die sogenannten Team-Europe-Initiativen (TEIs) die konkreten Aktivitäten der EU, ihrer Mitgliedsstaaten und gegebenenfalls weiterer Geber in einem Themenbereich und erhöhen auf diese Weise die Wirksamkeit und Sichtbarkeit der europäischen Außen- und Entwicklungspolitik.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die technische Zusammenarbeit (TZ) hat die Aufgabe, die Fähigkeiten von Menschen, Organisationen und Gesellschaften in den Partnerländern zu erhöhen (Capacity Development (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Sie sollen in die Lage versetzt werden, eigene Ziele selbst besser zu verwirklichen. Leistungen der technischen Zusammenarbeit sind vor allem Beratung, in begrenztem Umfang auch die Lieferung von Sachgütern, das Erstellen von Anlagen sowie Studien und Gutachten.
Die Vorhaben der technischen Zusammenarbeit werden überwiegend im Auftrag des BMZ von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) umgesetzt. Einige Leistungen werden durch spezialisierte Dienststellen, insbesondere die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)), erbracht. Technische Zusammenarbeit erfolgt immer als Direktleistung, die vom Empfängerland nicht zurückerstattet werden muss.
Das könnte Sie auch interessieren:
„The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)“ ist der Titel einer 2010 vorgelegten Studie zur wirtschaftlichen Bewertung von Biodiversität (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Ökosystemdienstleistungen. Sie wurde von Deutschland veranlasst und mitfinanziert. Inzwischen hat sich aus der Studie eine internationale Forschungsinitiative entwickelt.
Mit ihren vielfältigen Ökosystemen stellt die Natur den Menschen umfassende Leistungen und Ressourcen zur Verfügung. Hierzu gehören nicht nur die Produkte der Agrar- und Forstwirtschaft, sondern auch sauberes Wasser, gesunde Böden, Arzneiwirkstoffe, Schutz vor Überschwemmungen, Kohlenstoffspeicherung, Klimaregulierung, Erholung und vieles mehr. Derzeit wird diesen Ökosystemdienstleistungen nur in den seltensten Fällen ein volkswirtschaftlicher Wert zugeordnet, sie gelten als frei verfügbar. Die fehlende Wahrnehmung eines ökonomischen Wertes führt oft zu einer starken Übernutzung der Ökosysteme.
Um das Bewusstsein für den hohen Wert dieser Leistungen der Natur zu stärken, hat Deutschland gemeinsam mit der Europäischen Kommission die TEEB-Studie in Auftrag gegeben. Darin belegen die Autoren anhand konkreter Beispiele, dass der wirtschaftliche Wert der Natur deutlich größer ist als oftmals angenommen. Schätzungen gehen etwa davon aus, dass die rund 100.000 Schutzgebiete der Erde Leistungen im jährlichen Gegenwert von etwa fünf Milliarden US-Dollar erbringen.
Inzwischen wurde TEEB zur internationalen Initiative ausgeweitet, die Länderstudien erstellt und in den Arbeitsfeldern Landwirtschaft und Ernährung, ökonomische Bewertung von Ökosystemen, Wirtschaft und Unternehmen, Ozeane und Küsten, Gewässer und Feuchtgebiete sowie Arktis Daten sammelt, auswertet und veröffentlicht.
Ausführliche Informationen über das entwicklungspolitische Engagement Deutschlands zum Schutz der Biodiversität finden Sie hier.
Als Transformationsländer werden Staaten bezeichnet, die sich in einem Übergangsstadium von einer auf zentraler Planung beruhenden Wirtschaftsform in eine marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaftsordnung befinden. Hierzu gehören die mittel- und osteuropäischen Länder, die Gruppe der neuen unabhängigen Staaten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion sowie die südostasiatischen Länder Vietnam, Laos und Kambodscha.
Die Bundesregierung unterstützt seit Beginn der 1990er Jahre die politischen und wirtschaftlichen Reformen in diesen Staaten. Ziel dieser Förderung ist, den schwierigen Prozess der Umwandlung (Transformation) zu erleichtern und es diesen Ländern zu ermöglichen, ihren Platz in der Gemeinschaft demokratischer, marktwirtschaftlich orientierter Nationen einzunehmen.
Seit Beginn der Industrialisierung um 1800 hat der Mensch ungewollt massiv Einfluss auf den natürlichen Wärmehaushalt der Erde genommen, indem er durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre eingebracht hat. Zusammen mit Wasserdampf und anderen Gasen wie Methan, Lachgas und Fluorkohlenwasserstoffen reflektiert dieses Kohlendioxid einen Teil der Wärme, die früher in den Weltraum entweichen konnte, nun zurück zur Erde. Diese wird dadurch zunehmend aufgeheizt. Weil dieser Effekt dem Prinzip eines Treibhauses ähnelt, spricht man bei den entsprechenden Gasen von Treibhausgasen: Wie die Scheiben eines Gewächshauses verstärken sie die Wärme der Sonne und halten sie zurück. Treibhausgase sind für den weltweiten Klimawandel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verantwortlich.
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Verbot von Folter ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Artikel 5) und im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (Artikel 7) völkerrechtlich verankert.
Das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, Folter zu verhindern und strafrechtlich zu verfolgen. Die Antifolterkonvention wurde 1984 von der UN-Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) angenommen und trat 1987 in Kraft.
Als Kontrollorgan überwacht der UN-Antifolterausschuss (Committee against Torture (Externer Link)) die Einhaltung der Konvention. Alle Staaten, die sie ratifiziert haben, müssen dem Ausschuss regelmäßig berichten, wie sie die Konvention umsetzen.
Zusatzprotokoll
2002 verabschiedete die UN-Generalversammlung ein Zusatzprotokoll zur Antifolterkonvention, das seit 2006 in Kraft ist. Mit der Ratifizierung verpflichten sich die Vertragsstaaten, einen nationalen Präventionsmechanismus einzurichten. Regelmäßige Kontrollbesuche in Gefängnissen und anderen Einrichtungen, in denen Menschen die Freiheit entzogen ist, sollen Folter vorbeugen.
Die Antifolterkonvention wurde von 174 Staaten ratifiziert, das Zusatzprotokoll von 94 Staaten (Stand: September 2024). Die Deutsche Demokratische Republik ratifizierte die Konvention 1987, die Bundesrepublik Deutschland 1990. Deutschland trat dem Zusatzprotokoll 2008 bei.
Externe Links:
Die Konvention 138 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) von 1973 verpflichtet die Mitgliedsstaaten, Kinderarbeit abzuschaffen und ein gesetzliches Mindestalter für die Zulassung zu Beschäftigung und Arbeit festzulegen. Dieses Mindestalter soll die volle körperliche und geistige Entwicklung der Jugendlichen sichern und bei mindestens 15 Jahren liegen. Bei Tätigkeiten, die die Entwicklung von Jugendlichen gefährden, fordert die Konvention ein Mindestalter von 18 Jahren. Personen im Alter von 13 bis 15 Jahren dürfen nur dann leichten Beschäftigungen nachgehen, wenn diese nicht gesundheits- oder entwicklungsschädlich sind und wenn sie nicht den Schulbesuch oder die berufliche Ausbildung beeinträchtigen.
Die Konvention 138 zählt zu den sogenannten Kernarbeitsnormen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der ILO.
Externer Link:
Die Konvention 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) von 1999 verpflichtet die Mitgliedsstaaten dazu, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu verbieten und zu beseitigen. Dazu zählen unter anderem Versklavung, Schuldknechtschaft, Kinderhandel, Prostitution, Pornographie, Zwangsrekrutierung als Kindersoldatinnen oder -soldaten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), der Einsatz von Kindern in unerlaubten Tätigkeiten wie beispielsweise Drogenhandel sowie die Arbeit von Kindern, die für ihre Gesundheit, Sicherheit oder ihre Entwicklung schädlich ist.
Die Konvention schreibt den Unterzeichnerstaaten außerdem vor, nationale Aktionspläne zur Bekämpfung der Kinderarbeit zu verabschieden. Diese sollen vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Kinder, Hilfe bei der Rehabilitation und Aufklärungskampagnen über die Schädlichkeit von Kinderarbeit umfassen.
Die Konvention 182 zählt zu den sogenannten Kernarbeitsnormen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der ILO.
Externer Link:
Durch die UN-Konvention über die Rechte des Kindes von 1989 wurden die Kinderrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) völkerrechtlich verbindlich ausformuliert. Die Kinderrechtskonvention gilt für alle Kinder und Jugendlichen, die jünger als 18 Jahre sind. Sie umfasst 54 Artikel, die weltweit gültige Maßstäbe für eine kindgerechte Gesellschaft und auch die Aufgaben von Staat und Gesellschaft zur Durchsetzung dieser Rechte beschreiben.
Die Konvention definiert bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von Kindern. Sie ist in drei Rechtskategorien gegliedert:
- Förderrechte, die die Versorgung und Entwicklung von Kindern gewährleisten;
- Schutzrechte, die Kinder vor Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung und in Flucht- und Krisensituationen schützen sowie
- Beteiligungsrechte, die Kindern garantieren, an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt und gehört zu werden.
Das Wohl des Kindes vorrangig zu beachten ist ein zentrales Prinzip der Kinderrechtskonvention, an das sich staatliche Behörden der Vertragsstaaten halten müssen. Weitere zentrale Prinzipien der Kinderrechtskonvention sind das Verbot der Diskriminierung, das Recht auf Leben und Entwicklung und das Recht auf Partizipation (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Als Kontrollorgan überwacht der UN-Kinderrechtsausschuss (Committee on the Rights of the Child (Externer Link)) die Einhaltung des Übereinkommens. Alle Staaten, die sie ratifiziert haben, müssen dem Ausschuss regelmäßig berichten, wie sie die Konvention umsetzen.
Zusatzprotokolle
Seit dem Jahr 2000 hat die Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen drei Zusatzprotokolle zur Kinderrechtskonvention verabschiedet: Das erste trat 2002 in Kraft und untersagt Vertragsstaaten, Personen unter 18 Jahren an bewaffneten Konflikten teilnehmen zu lassen. Das zweite Protokoll trat ebenfalls 2002 in Kraft und verbietet Kinderhandel, -prostitution und -pornographie. Das dritte Protokoll ist seit 2011 in Kraft und sieht die Möglichkeit der Individualbeschwerde vor: Kinder und Jugendliche, die ihre in der Konvention verankerten Rechte als verletzt ansehen und den nationalen Rechtsweg ausgeschöpft haben, können Beschwerde beim UN-Kinderrechtsausschuss einlegen.
Die Kinderrechtskonvention hat die größte internationale Zustimmung von allen Menschenrechtsabkommen: Sie wurde von 196 Staaten ratifiziert. 173 Staaten haben das erste Zusatzprotokoll, 178 Staaten das zweite und 52 Staaten das dritte Zusatzprotokoll ratifiziert (Stand: September 2024). Deutschland trat der Konvention 1992 bei und hat alle drei Zusatzprotokolle ratifiziert.
Externer Link:
Das könnte Sie auch interessieren:
Die UN-Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verabschiedete 2006 die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) Sie trat 2008 in Kraft. Kernprinzipien des Übereinkommens sind Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen sowie ihre Inklusion. Als Inklusion wird das gleichberechtigte Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen bezeichnet. Ziel der Konvention ist es, Menschen mit Behinderungen Chancengleichheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
In Bezug auf die Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sollen die Vertragsstaaten sicherstellen, dass alle Entwicklungsprogramme Kinder und Erwachsene mit Behinderungen einbeziehen und für sie zugänglich sind. Partnerländer sollen bei der Umsetzung der Konvention unterstützt werden.
Als Kontrollorgan überwacht der UN-Behindertenrechtsauschuss (Committee on the Rights of Persons with Disabilities (Externer Link)) die Einhaltung der Konvention. Alle Staaten, die die Konvention ratifiziert haben, müssen dem Ausschuss regelmäßig berichten, wie sie die Konvention umsetzen.
Zusatzprotokoll
Gemeinsam mit der Behindertenrechtskonvention verabschiedete die UN-Generalversammlung ein Zusatzprotokoll, das ebenfalls 2008 in Kraft trat. Es sieht die Möglichkeit der Individualbeschwerde vor: Menschen, die sich in ihren in der Konvention verankerten Rechten verletzt sehen und den nationalen Rechtsweg ausgeschöpft haben, können beim UN-Behindertenrechtsausschuss Beschwerde einlegen.
191 Staaten haben die Behindertenrechtskonvention ratifiziert und 106 Staaten das Zusatzprotokoll (Stand: September 2024). Deutschland hat die Konvention und das Zusatzprotokoll 2009 ratifiziert.
Externer Link:
Das Übereinkommen 169 über Indigene Völker (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) aus dem Jahre 1989 ist das einzige rechtlich bindende internationale Vertragswerk, das einen umfassenden Schutz der Rechte Indigener Völker zum Gegenstand hat. Deutschland hat die ILO-Konvention 169 im Jahr 2021 ratifiziert, 2022 trat die Ratifikation in Kraft. Das Übereinkommen wurde bislang von 24 Staaten, vor allem in Lateinamerika, ratifiziert.
Externer Link:
„Gewaltsames Verschwindenlassen“ bedeutet, dass Menschen an einem geheimen Ort gefangen gehalten oder sogar getötet werden und die Behörden dies nicht zugeben. Die Familienangehörigen wissen nicht, ob die Person noch lebt oder wo sie begraben ist; sie suchen die Person oft jahrzehntelang vergeblich und riskieren dabei, selbst ins Visier der Behörden zu kommen.
2006 verabschiedete die UN-Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) das Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen. Es trat 2010 in Kraft.
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Verschwindenlassen von Personen unter Strafe zu stellen. Ein Freiheitsentzug darf nur in offiziell anerkannten Einrichtungen stattfinden, in denen alle Gefangenen registriert sind; Behörden müssen eine Person suchen, wenn es einen Verdacht auf gewaltsames Verschwindenlassen gibt. Neben dem Recht auf Wiedergutmachung haben Familienangehörige ein Recht darauf, die Wahrheit über den Verbleib der vermissten Person zu erfahren.
Die Konvention gegen Verschwindenlassen haben 76 Staaten ratifiziert (Stand: September 2024). Deutschland ist der Konvention 2009 beigetreten.
Als Kontrollorgan überwacht der UN-Ausschuss gegen Verschwindenlassen (Committee on Enforced Disappearances (Externer Link)) die Einhaltung der Konvention. Alle Staaten, die sie ratifiziert haben, müssen dem Ausschuss regelmäßig berichten, wie sie die Konvention umsetzen.
Externer Link:
Die Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen verabschiedete 1979 das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (Frauenrechtskonvention). Es trat 1981 in Kraft. Die Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten zur rechtlichen und faktischen Gleichstellung von Frauen in allen Lebensbereichen, einschließlich der Privatsphäre. Der Staat muss aktiv dafür sorgen, Chancengleichheit im gesellschaftlichen Alltag zu erreichen und darf selbst nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. Er ist verpflichtet, eine aktive Politik zur Beseitigung der Diskriminierung von Frauen zu verfolgen.
Als Kontrollorgan überwacht der UN-Frauenrechtsausschuss (Committee on the Elimination of Discrimination against Women (Externer Link)) die Einhaltung der Konvention. Alle Staaten, die sie ratifiziert haben, müssen dem Ausschuss regelmäßig berichten, wie sie die Konvention umsetzen.
Zusatzprotokoll
1999 verabschiedete die UN-Generalversammlung ein Zusatzprotokoll zur Frauenrechtskonvention, das seit 2000 in Kraft ist. Das Protokoll sieht die Möglichkeit der Individualbeschwerde vor: Frauen, die ihre im Übereinkommen verankerten Rechte als verletzt ansehen und den nationalen Rechtsweg ausgeschöpft haben, können Beschwerde beim UN-Frauenrechtsausschuss einlegen.
Die Konvention wurde von 189 Staaten ratifiziert, das Zusatzprotokoll von 115 Staaten (Stand: September 2024). Die Bundesrepublik Deutschland ratifizierte die Konvention 1973, die Deutsche Demokratische Republik 1980. Deutschland trat dem Zusatzprotokoll 2002 bei.
Das könnte Sie auch interessieren:
Externe Links:
- Informationen von UN Women Deutschland zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau (Externer Link)
- Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (PDF 47 KB) (Externer Link)
Aus der Menschenwürde ergibt sich der Anspruch aller Menschen, als Gleiche geachtet und geschützt zu werden. Rassismus verneint diesen Anspruch und steht der Menschenrechtsidee damit fundamental entgegen. Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung (Anti-Rassismus-Konvention) soll sicherstellen, dass Menschen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vor rassistischer Diskriminierung geschützt werden. Es wurde als erstes verbindliches Menschenrechtsabkommen 1965 von der Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verabschiedet und trat 1969 in Kraft.
Die Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten zu einer Politik, die sich umfassend gegen jede Form von Rassismus richtet. Als Kontrollorgan überwacht der UN-Antirassismus-Ausschuss (Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Externer Link)) die Einhaltung des Übereinkommens. Alle Staaten, die sie ratifiziert haben, müssen dem Ausschuss regelmäßig berichten, wie sie die Konvention umsetzen.
182 Staaten haben die Anti-Rassismus-Konvention ratifiziert (Stand: September 2024). Die Bundesrepublik Deutschland ratifizierte sie 1969, die Deutsche Demokratische Republik 1979.
Externer Link:
Die natürliche Umwelt und ihre vielfältigen Ökosysteme erbringen wichtige Leistungen für den Menschen, sowohl als Lebens- als auch als Wirtschaftsgrundlage. Wissenschaftliche Untersuchungen zum globalen Zustand der Umwelt zeigen allerdings sehr deutlich, dass sie hochgradig gefährdet ist. Die Zerstörung natürlicher Ressourcen gefährdet zunehmend die Existenzgrundlage vor allem armer Menschen in Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Gleichzeitig zwingt die Not die Armen oftmals zum Raubbau an der Natur.
Umweltschutz und das Management natürlicher Ressourcen sind deshalb ein Schwerpunkt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Ziel ist, gleichzeitig die biologische Vielfalt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu erhalten und Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) erfolgreich zu bekämpfen. Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt hierzu die Umsetzung internationaler Regelwerke zur Bekämpfung der Wüstenbildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), zur Verminderung der Treibhausgase (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), zur Förderung erneuerbarer Energien (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), zum Schutz der Wälder (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und zum Erhalt der Artenvielfalt. Außerdem beteiligt Deutschland sich an Maßnahmen zum Schutz vor Naturkatastrophen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Ausführliche Informationen über das deutsche Engagement zum Schutz der Umwelt finden Sie hier.
Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme, UNEP) ist ein Unterorgan der UN-Generalversammlung. Es wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Nairobi (Kenia). Das UNEP identifiziert und analysiert Umweltprobleme, arbeitet Grundsätze des Umweltschutzes aus, entwickelt regionale Umweltschutzprogramme und unterstützt Entwicklungsländer beim Aufbau von nationalen Umweltschutzprogrammen. Themenbereiche sind Klimawandel, Katastrophen und Konflikte, Ökosystemmanagement, Umweltmanagement, Chemikalien und Abfall, Ressourceneffizienz und Umweltbeobachtung.
Alle zwei Jahre gibt das UNEP einen Bericht über die Umweltsituation der Welt heraus.
- Externer Link: Website des UNEP (englisch) (Externer Link)
Umweltstandards sind Vorgaben, die bestimmte Umweltschutzmaßnahmen und umweltfreundliche Produktionsverfahren für Unternehmen definieren. Sie haben den Zweck, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen auch für zukünftige Generationen zu erhalten sowie den Schutz der Umwelt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der menschlichen Gesundheit zu gewährleisten.
Umweltstandards orientieren sich an naturwissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Erkenntnissen und Wertvorstellungen. Rechtliche Verbindlichkeit erhalten sie durch staatliche Regelungen auf nationaler oder internationaler Ebene – etwa in Form von Grenzwerten oder Pflichtkennzeichnungen. Auch als freiwillige Übereinkunft, zum Beispiel im ökologischen Landbau, können Umweltstandards festgelegt werden.
Die Bundesrepublik unterstützt ihre Partnerländer bei der Einführung solcher Standards.
Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA)
Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), die 1949 gegründet wurde, um palästinensischen Geflüchtete in Jordanien, Libanon, Syrien, dem Westjordanland und dem Gazastreifen humanitäre Hilfe und grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen. Ihr Mandat umfasst die Versorgung mit Bildung, Gesundheitsversorgung, soziale Dienste und Notfallhilfe, mit dem Ziel, das Überleben und die Lebensqualität der palästinensischen Geflüchteten zu sichern.
Ein Schwerpunkt der UNRWA liegt auf Bildung. Die Agentur betreibt hunderte Schulen in der Region und ist verantwortlich für die Bereitstellung von kostenlosem Unterricht für Millionen von Kindern von Geflüchteten. Darüber hinaus bietet sie Berufsbildung, Erwachsenenbildung und spezielle Programme zur Förderung von Chancengleichheit und Integration an. Im Bereich Gesundheit sorgt die UNRWA für Zugang zu medizinischer Grundversorgung und präventiver Gesundheitsversorgung.
Die UNRWA veröffentlicht regelmäßig Berichte über ihre Programme und die Lebensbedingungen der palästinensischen Geflüchtete, um Transparenz zu gewährleisten und internationale Unterstützung zu mobilisieren.
→ Externer Link: Website des UNRWA (Externer Link) (englisch)
Die Union für den Mittelmeerraum (UfM) ist eine seit Juli 2008 bestehende Partnerschaft zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und 16 Anrainerstaaten des Mittelmeerraumes. (Die Mitgliedschaft von Syrien ist allerdings seit 2011 ausgesetzt.) Die Union ging aus dem Barcelona-Prozess (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) hervor. Die beteiligten Länder repräsentieren mehr als 700 Millionen Menschen. Die UfM basiert auf der gegenseitigen Achtung der Souveränität aller Teilnehmer und soll durch regionale Zusammenarbeit und Integration helfen, Frieden, Demokratie, Stabilität, Sicherheit und Wohlstand in der Region zu fördern.
Die UN-Generalversammlung ist das wichtigste politische und repräsentative Organ der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), jeder Mitgliedsstaat hat in ihr das gleiche Stimmrecht. Sie tagt jährlich im September und kann über grundsätzliche Menschenrechtsfragen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) diskutieren. Die Generalversammlung verabschiedet Menschenrechtsinstrumente per Resolution. Sie hat den UN-Menschenrechtsrat (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) eingerichtet und vergibt dessen Sitze.
- Externer Link: Website der UN-Generalversammlung (englisch) (Externer Link)
Seit 1994 koordiniert das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte die Menschenrechtsarbeit der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Hauptaufgabe ist die Förderung und der Schutz der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) weltweit. Regierungen werden durch Regionalbüros dabei unterstützt, den Menschenrechtsschutz in ihrem Land zu stärken und in Einklang mit internationalen Standards zu bringen. Das Hochkommissariat fungiert außerdem als Sekretariat für die UN-Ausschüsse, die die Umsetzung der Menschenrechtsabkommen kontrollieren, für alle Sonderverfahren (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie für das Allgemeine Periodische Länderüberprüfungsverfahren des UN-Menschenrechtsrats (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Externer Link:
Auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro – besser bekannt als Erdgipfel oder Rio-Konferenz – trafen sich im Juni 1992 Vertreter aus 178 Ländern, um über Fragen zu Umwelt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Entwicklung im 21. Jahrhundert zu beraten. In Rio wurde das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) als internationales Leitbild anerkannt. Dahinter stand die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Effizienz, soziale Gerechtigkeit und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gleichwertige überlebenswichtige Interessen sind, die sich gegenseitig ergänzen.
Wichtige Ergebnisse dieser Konferenz sind die Rio-Deklaration, die Agenda 21 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie drei völkerrechtlich verbindliche Konventionen zum Klimaschutz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), zum Schutz der Biodiversität (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und zur Bekämpfung von Wüstenbildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Gemeinsam mit der Waldgrundsatzerklärung bilden sie die Grundlage für eine qualitativ neue weltweite Zusammenarbeit in der Umwelt- und Entwicklungspolitik.
Das könnte Sie auch interessieren:
Unternehmen haben erheblichen Einfluss auf die weltweite Verwirklichung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Um die Unternehmensverantwortung zu unterstreichen, hat der UN-Menschenrechtsrat (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) 2011 die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. Sie haben drei Säulen:
- Jeder Staat ist verpflichtet, die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen und Investitionen zu setzen, um den Schutz der Menschenrechte und Arbeitsnormen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu gewährleisten. Dazu gehören beispielsweise eine Umweltaufsicht und eine Arbeitsinspektion.
- Unternehmen sollen Verfahren einrichten, um mögliche negative Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Menschenrechte zu vermeiden, zu verringern oder auszugleichen.
- Personen, deren Menschenrechte durch Unternehmen verletzt wurden, müssen wirksame Abhilfe erhalten. Dazu gehören der Zugang zu staatlichen und nicht staatlichen Beschwerdestellen sowie die Möglichkeit, den Rechtsweg beschreiten zu können.
Nationaler Aktionsplan und Lieferkettengesetz
Zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien hat die Bundesregierung 2016 den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) beschlossen. Ein Ziel lautete, dass bis 2020 mindestens 50 Prozent aller in Deutschland ansässigen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten auf freiwilliger Basis einen Prozess zur Achtung der Menschenrechte entlang ihrer Liefer- und Wertschöpfungsketten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) eingeführt haben. Dieses Ziel wurde jedoch verfehlt. Aus diesem Grund wurde ein nationales Lieferkettengesetz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) erarbeitet, das im Januar 2023 in Kraft trat. Auch auf EU-Ebene wurde im Frühjahr 2024 eine Lieferkettenrichtlinie beschlossen. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Externe Links:
Der UN-Menschenrechtsrat ist ein Nebenorgan der UN-Generalversammlung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Er fördert den weltweiten Schutz der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und gibt Empfehlungen zum Umgang mit Menschenrechtsverletzungen ab.
Der Menschenrechtsrat hat 47 Mitglieder, die von der Generalversammlung für drei Jahre gewählt werden: 13 Sitze für afrikanische Staaten, 13 für asiatische und pazifische, 8 für lateinamerikanische und karibische, 6 für osteuropäische und 7 für westeuropäische und andere Staaten. Neben seinen regulären Sitzungen hält der Menschenrechtsrat Sondersitzungen zu menschenrechtlichen Themen und der Menschenrechtslage in einzelnen Ländern ab.
Im sogenannten Allgemeinen Periodischen Länderüberprüfungsverfahren (Universal Periodic Review) begutachtet der Menschenrechtsrat seit 2007 regelmäßig die Menschenrechtssituation in allen 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) . Er setzt auch Sonderberichterstatterinnen und Sonderberichterstatter (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu Menschenrechtsthemen oder zu einzelnen Ländern ein.
- Externer Link: Website des UN-Menschenrechtsrats (englisch) (Externer Link)
Der UN-Sicherheitsrat besteht aus fünf ständigen und zehn nichtständigen Mitgliedern. Seine Hauptaufgabe ist die Wahrung des Friedens (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der internationalen Sicherheit. Er kann gegen Staaten, die schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen begehen, politische und wirtschaftliche Sanktionen verhängen und bei Bedrohung des Friedens auch militärische Maßnahmen beschließen.
- Externer Link: Website des UN-Sicherheitsrats (englisch) (Externer Link)
Für die Untersuchung der Menschenrechtslage (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in bestimmten Ländern und für besonders menschenrechtsrelevante Themen kann der UN-Menschenrechtsrat (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Sonderberichterstatterinnen und Sonderberichterstatter, Arbeitsgruppen von Sachverständigen oder unabhängige Expertinnen und Experten einsetzen. Je nach Auftrag besuchen sie beispielsweise Gefängnisse, befragen Betroffene von Menschenrechtsverletzungen, treten in den Dialog mit Behörden und Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und formulieren anschließend Empfehlungen für einen besseren Menschenrechtsschutz. Im Rahmen thematischer Mandate befassen sie sich unter anderem mit Meinungsfreiheit, Folter, Religionsfreiheit, extremer Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Kinderhandel, Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und dem Recht auf Nahrung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Externer Link:
Die „United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women“, kurz UN Women, nahm Anfang 2011 ihre Arbeit auf. In UN Women gingen die bis dahin bestehenden Einheiten und Programme der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zum Thema Frauen und Gender (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) auf: der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen (UNIFEM), das Büro der Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen und Frauenförderung (OSAGI), die Abteilung für Frauenförderung (DAW) und das Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau (INSTRAW).
Aufgabe von UN Women ist es, das Thema Gleichstellung im gesamten UN-System zu fördern. Zum einen entwickelt die Organisation politische Ziele und wirkt weltweit auf die Einhaltung und Umsetzung internationaler Verpflichtungen hin. Zum anderen leistet sie entwicklungspolitische Programmarbeit im Bereich Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung und berät Mitgliedsstaaten und ihre Gremien.
Externe Links:
Das könnte Sie auch interessieren:
VENRO ist der Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären Nichtregierungsorganisationen (NROs (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) in Deutschland. Ihm gehören rund 140 Organisationen der privaten und kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), der humanitären Hilfe sowie der entwicklungspolitischen Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit an. VENRO vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Politik, stärkt die Rolle von NROs und der Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in der Entwicklungspolitik, setzt sich für die Interessen der Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und armer Bevölkerungsgruppen ein und schärft das öffentliche Bewusstsein für entwicklungspolitische Themen.
- Externer Link: Website von VENRO (Externer Link)
Die Vereinigung südostasiatischer Länder (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) ist eine internationale Organisation mit politischen, ökonomischen und kulturellen Zielen.
Die ASEAN-Mitgliedsstaaten sind Brunei Darussalam, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam.
Die Vereinten Nationen (United Nations, UN) sind ein zwischenstaatlicher Zusammenschluss von 193 souveränen Staaten. Sie wurden 1945 gegründet, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und sozialen Fortschritt, bessere Lebensbedingungen und Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu fördern. In der UN-Charta, dem Gründungsvertrag der Vereinten Nationen, sind die Rechte und Pflichten der Mitglieder der internationalen Gemeinschaft festgeschrieben.
Neben den Hauptorganen der Vereinten Nationen, die für Entscheidungsprozesse maßgeblich sind, gehören eine Reihe von UN-Fonds und Programmen (zum Beispiel UNICEF (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), UNDP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), UNAIDS (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), WFP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) und Sonderorganisationen (zum Beispiel FAO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), ILO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und WHO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) zum System der Vereinten Nationen. Diese nehmen spezifische Aufgaben wahr.
Durch den Vertrag von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft trat, hat die Europäische Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) einen neuen rechtlichen Rahmen erhalten. Der Vertrag sieht Änderungen in den bestehenden Verträgen (EU-Vertrag und EG-Vertrag) vor. Die Europäische Union tritt laut Lissabon-Vertrag die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) an.
Europäische Entwicklungszusammenarbeit im Vertrag von Lissabon
Im geänderten EG-Vertrag, der nun „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ genannt wird, ist die Politik der EU auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in den Artikeln 208 bis 211 festgeschrieben: Hauptziel der Union ist demnach die Bekämpfung und – auf längere Sicht – die Beseitigung der Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Der Vertrag von Lissabon hat die Rahmenbedingungen für die Außenbeziehungen der Europäischen Union verändert. Vor Inkrafttreten des Vertrags waren drei Generaldirektionen mit der Entwicklungszusammenarbeit der EU befasst: Die Generaldirektion Entwicklung war für die Formulierung und Planung der Entwicklungszusammenarbeit in den AKP-Staaten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zuständig, während die Generaldirektion Außenbeziehungen für die restlichen Länder verantwortlich war. Die Durchführung der Entwicklungsprogramme und -projekte war Aufgabe des Europäischen Amts für Zusammenarbeit (EuropeAid (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)).
Der Vertrag von Lissabon ordnet Entwicklungspolitik nun als „gemeinsame Kompetenz“ sowohl dem neu geschaffenen Amt des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) als auch dem EU-Kommissar für internationale Partnerschaften zu. So soll die Verknüpfung der europäischen Entwicklungs- und Außenpolitik verbessert werden.
Zur Unterstützung des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik wurde der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) geschaffen. Er teilt sich die Verantwortung für die Koordinierung der EU-Entwicklungszusammenarbeit mit der Generaldirektion Internationale Partnerschaften (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
- Externer Link: Vertrag von Lissabon (PDF 2 MB) (Externer Link)
Das Adjektiv „vulnerabel“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „verwundbar“ oder „verletzlich“. Als vulnerable Bevölkerungsgruppen versteht man in der Entwicklungszusammenarbeit Menschen, die nicht in der Lage sind, Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen, und daher unter Krisen besonders leiden.
Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist eine häufige, meist aber nicht die einzige Ursache für eine besondere Verwundbarkeit. Auch politische und gesellschaftliche Benachteiligungen und mangelnder Zugang zu einer gleichberechtigten Teilhabe (Partizipation (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) macht Menschen verletzlich.
Zu den besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen zählen Frauen, Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, Menschen auf der Flucht, LSBTIQ+ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie ethnische und religiöse Minderheiten.
Das könnte Sie auch interessieren:
Wälder sind von großer globaler Bedeutung: Sie gehören zu den artenreichsten Lebensräumen der Erde, bilden Sauerstoff, binden Kohlendioxid und regulieren das Weltklima. Als Lieferant von Nahrung, Wasser, Baumaterial, Brennstoffen, Rohstoffen und Heilpflanzen bilden sie die Lebensgrundlage für Millionen von Menschen, oftmals aus den ärmsten Bevölkerungsschichten.
Doch insbesondere die tropischen Regenwälder sind in Gefahr: Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gingen zwischen 1990 und 2020 rund 420 Millionen Hektar Wald verloren. Alle vier Sekunden wird eine Waldfläche in der Größe eines Fußballfeldes durch landwirtschaftliche Nutzung, illegalen Holzeinschlag, Brandrodung, Besiedelung oder andere Formen des Flächenverbrauchs zerstört.
Der Schutz der Wälder ist darum ein wichtiges Anliegen der deutschen Entwicklungspolitik. Durch die globale Bedeutung der Wälder dient dieses Engagement den Menschen in den Partnerländern ebenso wie den Menschen in Deutschland.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) hatten im Jahr 2022 etwa 2,2 Milliarden Menschen keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. 3,5 Milliarden Menschen verfügten über keine hygienisch sicheren Sanitäreinrichtungen. Wassermangel und schlechte Wasserqualität sowie fehlende oder schlechte Sanitärversorgung gehören zu den Hauptursachen für Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Krankheit und Zerstörung der Umwelt.
Deutschland zählt zu den größten bilateralen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Gebern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) im Wassersektor. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) setzt sich auf vielfältige Weise für eine nachhaltige (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Bewirtschaftung der Wasserressourcen und eine sichere Trinkwasser- und Sanitärversorgung für alle Menschen ein. Ausführliche Informationen über die Arbeit des BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) im Bereich Wasser- und Sanitärversorgung finden Sie hier.
Der Begriff „Weibliche Genitalverstümmelung“ (englisch: Female Genital Mutilation, FGM) umfasst alle Verfahren, bei denen die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane ohne medizinische Notwendigkeit teilweise oder vollständig entfernt werden. Es handelt sich dabei um eine schwere Verletzung der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), etwa des Rechts auf Gesundheit und des Rechts auf körperliche Unversehrtheit.
Die schädliche Praktik wird vielfach als soziale Norm aufgrund tief verankerter Wert- und Moralvorstellungen oder fälschlicherweise als religiöses Gebot angesehen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind weltweit mindestens 230 Millionen Frauen und Mädchen von Genitalverstümmelung betroffen. In rund 30 Ländern wird sie praktiziert, zumeist in Afrika, aber auch in einigen arabischen und asiatischen Ländern. Auch Migrantinnen in der ganzen Welt sind betroffen. Der Eingriff wird meist bei Mädchen im Alter zwischen vier und 14 Jahren vorgenommen, manchmal aber auch schon bei Säuglingen oder aber kurz vor der Eheschließung oder vor der Geburt des ersten Kindes.
Eine Genitalverstümmelung hat keinerlei gesundheitlichen Nutzen und sie kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle Formen dieser Praktik können schwere körperliche, psychische und soziale Folgen haben und sogar zum Tod führen.
Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie hier.
Die Weltbank wurde im Juli 1944 auf der Währungs- und Finanzkonferenz der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in Bretton Woods (USA) zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gegründet. Sie ist wie der IWF eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Ursprünglich war ihr Ziel, nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau zu fördern und in Zusammenarbeit mit dem IWF stabile Währungen zu schaffen. Seit den 1960er Jahren ist es ihre Hauptaufgabe, die Armut (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in der Welt zu bekämpfen und die Lebensbedingungen der Menschen in den Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu verbessern. So trägt sie zum Erreichen der internationalen Entwicklungsziele bei.
Die Weltbankgruppe besteht aus fünf Organisationen:
- Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Internationale Finanz-Corporation (IFC) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (MIGA) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Internationales Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Die Weltbank im engeren Sinne umfasst nur die IBRD und die IDA.
Informationen über die Zusammenarbeit des BMZ mit der Weltbank finden Sie hier.
- Externer Link: Website der Weltbankgruppe (englisch) (Externer Link)
Das Welternährungsprogramm (World Food Programme, WFP) wurde von den Vereinten Nationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) gegründet. Seine Aufgabe ist es, Bedürftige in besonderen Notlagen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, zum Beispiel Opfer von Krieg, Ernteausfall, Dürre, Überflutung, Erdbeben, Sturm und anderen Naturkatastrophen. Ist die Krise überstanden, hilft das WFP den Menschen dabei, zerstörte Lebensgrundlagen wiederaufzubauen. Darüber hinaus unterstützt es auch breiter angelegte Entwicklungsprogramme in Entwicklungsländern, in denen Nahrungsmittelhilfe als ein Instrument zur mittelfristigen Ernährungssicherung eingesetzt wird.
Das BMZ betrachtet die Zusammenarbeit mit dem WFP als wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherung im Rahmen der strukturbildenden Übergangshilfe.
Auch im Rahmen der Sonderinitiative „Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“ arbeitet das BMZ mit dem Welternährungsprogramm zusammen.
- Externer Link: Website des Welternährungsprogramms (Externer Link)
Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) ist die wichtigste UN-Sonderorganisation im Gesundheitsbereich. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Auf- und Ausbau leistungsfähiger Gesundheitsdienste und die Unterstützung von Industrie- und Entwicklungsländern bei der Bekämpfung von Krankheiten. Darüber hinaus fördert die WHO die medizinische Forschung und übernimmt die Aufgabe eines weltweiten Gesundheitswarndienstes.
Für die deutsche Entwicklungspolitik ist die WHO eine zentrale Instanz zur fachlichen Ausrichtung von Projekten und Programmen im Gesundheitsbereich. Das BMZ fördert zudem seit vielen Jahren Sonderprogramme der WHO, die insbesondere der Bekämpfung von Infektionskrankheiten dienen.
Weitere Informationen über die Zusammenarbeit des BMZ mit der WHO finden Sie hier:
Externer Link:
Auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg bekannte sich die internationale Gemeinschaft im Jahr 2002 – zehn Jahre nach der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) in Rio de Janeiro – erneut zur Nachhaltigkeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Es wurde vereinbart, die „sich gegenseitig stützenden Säulen der nachhaltigen Entwicklung – wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung und Umweltschutz – unter politisch stabilen Bedingungen auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene auszubauen und zu festigen“. Die Teilnehmer des Gipfels verabschiedeten einen Aktionsplan, der die Ziele der Millenniumserklärung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) bestätigte.
In der deutschen Öffentlichkeit wurde der Weltgipfel mit großem Interesse verfolgt. Viele neue Initiativen, Netzwerke und Allianzen, die bis heute bestehen, wurden im Umfeld des Weltgipfels gegründet.
Die Industriestaaten haben entscheidenden Einfluss auf die Weltwirtschaft. Sie tragen eine große Verantwortung dafür, dass der Welthandel gerecht betrieben wird. Damit auch die Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) von den Vorteilen der Globalisierung profitieren und ihre Armut mindern können, müssen ihre Interessen im Welthandelssystem besser berücksichtigt werden. Deutschland setzt sich daher für den Abbau von Agrarexportsubventionen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und anderen handelsverzerrenden Fördermaßnahmen der Industriestaaten ein.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Welthandels- und Entwicklungskonferenz (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) ist ein Organ der UN-Generalversammlung. Ihr Ziel ist es, Handel und Entwicklung auf weltweiter Ebene zu fördern. Dabei sollen alle Länder den größtmöglichen Nutzen aus der Integration in die Weltwirtschaft ziehen.
Für die Entwicklungsländer (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) erfüllt die UNCTAD eine wichtige Beratungs- und Servicefunktion. Sie verfügen in der Konferenz über die Stimmenmehrheit, die UNCTAD-Resolutionen haben jedoch lediglich empfehlenden Charakter.
- Externer Link: Website der UNCTAD (englisch) (Externer Link)
Neben dem Internationalen Währungsfonds (IWF) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der Weltbankgruppe (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) ist die Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) eine der zentralen Organisationen der Weltwirtschaftsordnung. Sie ist als einzige internationale Organisation dafür zuständig, Regeln für den internationalen Handel (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu formulieren. Die WTO-Verträge umfassen unter anderem Regeln für den Güterhandel, den Handel mit Dienstleistungen und den Schutz geistigen Eigentums. Vorrangiges Ziel der WTO ist der Abbau aller Hemmnisse, die den weltweiten Handel behindern.
Informationen über die Zusammenarbeit des BMZ mit der WTO finden Sie hier.
- Externer Link: Website der WTO (englisch) (Externer Link)
Die Weltstaudammkommission (World Commission on Dams, WCD) wurde 1998 auf Initiative der Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der World Conservation Union (IUCN) gegründet, um die Auswirkungen des Baus großer Staudämme zu untersuchen. Im Jahr 2000 veröffentlichte die WCD einen international anerkannten Abschlussbericht, der sowohl Chancen als auch Risiken großer Staudammprojekte benennt und unter anderem Richtlinien für die Beteiligung aller Betroffenen aufstellt.
Die WCD wurde im Jahr 2001 aufgelöst. Ihre Arbeit wurde zunächst vom Projekt für Dämme und Entwicklung (Dams and Development Project, DDP) sowie später von verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen wie dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) fortgesetzt.
Der wirtschaftswissenschaftliche Fachbegriff „Wertschöpfungskette“ beschreibt die Abfolge aller Herstellungs- und Vermarktungsstufen für ein Produkt: von der Herstellung des Rohstoffs über die Verarbeitung und den Transport bis hin zum Handel und schließlich zum Konsum durch die Endverbraucherinnen und -verbraucher. Jede dieser Stufen schafft einen zusätzlichen ökonomischen Wert.
Der Begriff umfasst außerdem die Gesamtheit der Beteiligten. Zu einer landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette gehören also zum Beispiel die produzierenden Bäuerinnen und Bauern, die verarbeitende Lebensmittelindustrie, der Groß- und Einzelhandel sowie Transport-, Logistik- und Exportunternehmen, aber auch die Bereitsteller von Service- und Dienstleistungen wie Kreditinstitute oder landwirtschaftliche Beratungsdienste.
In der Entwicklungszusammenarbeit werden Wertschöpfungsketten mit dem Ziel gefördert, möglichst viele Prozesse in das entsprechende Entwicklungsland zu verlagern, damit möglichst viel Wertschöpfung im Land verbleibt. Mit verarbeiteten Produkten lässt sich in der Regel mehr Gewinn erzielen als mit Rohstoffen, zugleich werden dringend benötigte Arbeitsplätze geschaffen.
Mehr über das deutsche Engagement für Fairness in globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten lesen Sie hier.
Informationen über landwirtschaftliche Wertschöpfungs- und Lieferketten finden Sie hier.
Informationen über die Förderung nachhaltiger Wertschöpfungs- und Lieferketten in der Textilindustrie finden Sie hier.
Die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (Economic Community Of West African States, ECOWAS) wurde 1975 mit dem Ziel gegründet, die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Westafrika zu fördern. Sie ist die älteste und aktivste regionale Organisation auf dem afrikanischen Kontinent. Die zentralen Organe der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft sind die Kommission, das Parlament (Community Parliament) und der Gerichtshof (Community Court of Justice) sowie die Bank für Investition und Entwicklung (ECOWAS Bank for Investment and Development, EBID) und die Westafrikanische Gesundheitsorganisation (West African Health Organisation, WAHO).
Die Organisation hat sich zu einer treibenden Kraft der wirtschaftlichen und politischen Integration in der Region entwickelt und nimmt zunehmend eine aktive Rolle als Friedens- und Sicherheitsakteur ein. Das Aufgabenspektrum der ECOWAS wurde fortlaufend erweitert und umfasst zahlreiche politische, kulturelle und soziale Elemente. Dazu zählen unter anderem zivil-militärische Friedenseinsätze und Maßnahmen zur Krisenprävention, die Modernisierung der regionalen Infrastruktur, die Förderung des freien Personen- und Warenverkehrs und die Zusammenarbeit im Gesundheitssektor. Mit der 2022 verabschiedeten „Vision 2050“ orientiert sich die ECOWAS an internationalen und regionalen Agenden – insbesondere den SDGs (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der Agenda 2063 der Afrikanischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Neben der ECOWAS-Kommission arbeitet die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit spezialisierten ECOWAS-Organen zusammen: ECOWAS Peace and Security Architecture and Operations (EPSAO), West African Health Organisation (WAHO) und West African Power Pool (WAPP). Das laufende Gesamtportfolio beläuft sich auf rund 560 Millionen Euro. Die Zusammenarbeit mit der ECOWAS fokussiert sich auf folgende Kernthemen:
- Frieden und gesellschaftlicher Zusammenhalt
- Klima und Energie, Just Transition (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
- Nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Ausbildung und Beschäftigung
- Gesundheit, soziale Sicherung und Bevölkerungspolitik
Die aktuell 12 Mitgliedsstaaten der ECOWAS sind: Benin, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone und Togo.
Die Mitgliedschaft von Mali, Niger, Burkina Faso und Guinea wurde wegen der dortigen Putsche ausgesetzt. Im Januar 2024 haben die Militärregierungen von Mali, Burkina Faso und Niger ihren Austritt aus der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft erklärt.
- Externer Link: Website der ECOWAS (englisch) (Externer Link)
Die Abkürzung „WSK-Rechte“ steht für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Völkerrechtlich verankert sind sie im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)). Der Pakt verpflichtet Staaten dazu, Schritt für Schritt den diskriminierungsfreien Zugang zu den WSK-Rechten zu gewährleisten, darunter die Rechte auf Gesundheit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Bildung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Arbeit, Wohnen, Wasser (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Sanitärversorgung und Teilhabe am kulturellen Leben. Die WSK-Rechte sind somit die Grundlage für menschenwürdige Lebensverhältnisse und die Chance auf gesellschaftliche Teilhabe.
Der Schutz vor Diskriminierung ist ein zentraler Bestandteil aller Menschenrechtspakte. Dennoch erleben Menschen nach wie vor Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Welche spezifischen Gefährdungslagen die Staaten zum Schutz der Menschenrechte (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und intergeschlechtlichen Personen (LSBTIQ+ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) aufgreifen müssen, hat eine Gruppe internationaler Fachleute 2006 in den Yogyakarta-Prinzipien aufgefächert. 2017 wurden weitere zehn Prinzipien hinzugefügt.
Ziel der Prinzipien ist, Gewalt gegen und strafrechtliche Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung zu bekämpfen. Zu den Prinzipien gehören der Grundsatz der Chancengleichheit und Gleichberechtigung von LSBTIQ+-Personen bei der Umsetzung ihrer Menschenrechte sowie ihre aktive politische und gesellschaftliche Teilhabe in allen Lebensbereichen.
Die Yogyakarta-Prinzipien sind nicht rechtsverbindlich. Doch indem sie das Diskriminierungsverbot und andere Bestimmungen der verbindlichen Menschenrechtskonventionen auf LSBTIQ+-Personen anwenden, haben sie durchaus rechtliche und politische Bedeutung.
Externe Links:
Die Zentralafrikanische Forstkommission (Commission des Forêts d'Afrique Central, COMIFAC) widmet sich dem Schutz des Tropenwalds im Kongobeckenmassiv, einem der wichtigsten Ökosysteme der Erde. Sie entstand auf Grundlage der Yaoundé-Deklaration von 1999, in der die Regierungen der Anrainerstaaten des Kongobeckens – Äquatorialguinea, Gabun, Kamerun, Republik Kongo, Tschad, Zentralafrikanische Republik – eine Zusammenarbeit vereinbart hatten. Seitdem sind auch Angola, Burundi, die Demokratische Republik Kongo, Ruanda sowie São Tomé und Príncipe der COMIFAC beigetreten.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Stichwort: Wald (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)
Die Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, CEMAC) ist eine afrikanische Regionalorganisation bestehend aus den sechs Staaten Äquatorialguinea, Gabun, Kamerun, Republik Kongo, Tschad und Zentralafrikanische Republik.
Zu den wichtigsten Anliegen der CEMAC gehören ein gemeinsamer Wirtschafts- und Währungsraum, ein freier Personen-, Waren- und Kapitalverkehr, die Zusammenarbeit in wirtschafts- und sicherheitspolitischen Fragen sowie die Förderung nachhaltiger Entwicklung (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
- Externer Link: Website der CEMAC (französisch) (Externer Link)
Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) ist eine Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit. Sie ist für die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland und für die Vermittlung besonderer Berufsgruppen verantwortlich. Unter anderem setzt sie die gesetzliche Verpflichtung der Bundesagentur um, im Bereich der Arbeitsvermittlung auch die Bedürfnisse von Entwicklungsländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und internationalen Organisationen zu berücksichtigen. Die ZAV hat dazu mit der GIZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) das Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) gegründet.
Außerdem betreut die ZAV im Auftrag des Auswärtigen Amtes das Büro Führungskräfte zu Internationalen Organisationen (BFIO). Es berät hoch qualifizierte deutsche Bewerberinnen und Bewerber, die sich für eine Arbeit in internationalen Organisationen interessieren.
Darüber hinaus ist das BFIO für das Programm Beigeordnete Sachverständige (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verantwortlich, das die Entsendung deutscher Nachwuchskräfte in internationale Organisationen fördert. Die Federführung für dieses Programms liegt beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)).
Externe Links:
Der Zivile Friedensdienst (ZFD) ist ein erfolgreiches Kooperationsmodell von staatlichen und nichtstaatlichen Trägern der Entwicklungs- und Friedensarbeit. Ziel des ZFD ist, den gewaltfreien Umgang mit Konflikten und Konfliktpotenzialen zu fördern. Speziell ausgebildete Friedensfachkräfte unterstützen weltweit in Krisenregionen Partnerorganisationen dabei, Grundlagen für einen nachhaltigen Frieden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu schaffen. Sie vermitteln im Konflikt, bringen Anliegen benachteiligter Menschen an die Öffentlichkeit, begleiten ehemalige Soldaten auf ihrem Weg ins zivile Leben und ermöglichen Flüchtlingen die Rückkehr in ihre Heimat. Der ZFD ist ein wichtiges Instrument der deutschen Friedensentwicklung. Er wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) finanziert.
Ausführliche Informationen über den Zivilen Friedensdienst finden Sie hier.
Ein ursprünglich unter anderem vom italienischen Theoretiker Antonio Gramsci (1891–1937) entwickelter Begriff. Er verstand darunter die Gesamtheit aller nichtstaatlichen Organisationen, die auf den „Alltagsverstand und die öffentliche Meinung“ Einfluss haben.
Heute umschreibt der Begriff einen Bereich innerhalb der Gesellschaft, der zwischen dem staatlichen, dem wirtschaftlichen und dem privaten Sektor angesiedelt ist. Die Zivilgesellschaft umfasst die Gesamtheit des Engagements der Bürgerinnen und Bürger eines Landes – zum Beispiel in Vereinen, Verbänden und vielfältigen Formen von Initiativen und sozialen Bewegungen. Dazu gehören alle Aktivitäten, die nicht profitorientiert und nicht abhängig von parteipolitischen Interessen sind.
Verschiedene Politikwissenschaftler beschreiben die Zivilgesellschaft als Komponente, die neben dem Staat und den Kräften des Marktes notwendig ist, um eine ideale pluralistische Gesellschaft von engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Durch ein Patent wird dem Inhaber das alleinige Recht eingeräumt, den patentierten Gegenstand herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Er kann dieses Recht an Lizenznehmer verkaufen. Die Zwangslizenz ist eine ohne oder gegen den Willen des Patentinhabers eingeräumte Erlaubnis, ein Patent in bestimmter Weise zu nutzen. Grund für die Erteilung einer Zwangslizenz ist allgemeines öffentliches Interesse, zum Beispiel die Versorgung der Bevölkerung mit wichtigen Medikamenten.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Abgrenzung zwischen Flucht und Migration ist in der Praxis im Umgang mit Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, nicht immer trennscharf möglich. Nach der Genfer Konvention ist eine Person, die beispielsweise sich und ihre Familie vor Hunger retten will, kein Flüchtling (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), sondern eine Migrantin oder ein Migrant (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen).
Auch wer seine Heimat aufgrund einer Naturkatastrophe verlässt, hat den Status einer Migrantion oder eines Migranten und fällt somit nicht unter den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention (Externer Link). Solche Schicksale werden als Zwangsmigration (forced migration) bezeichnet.