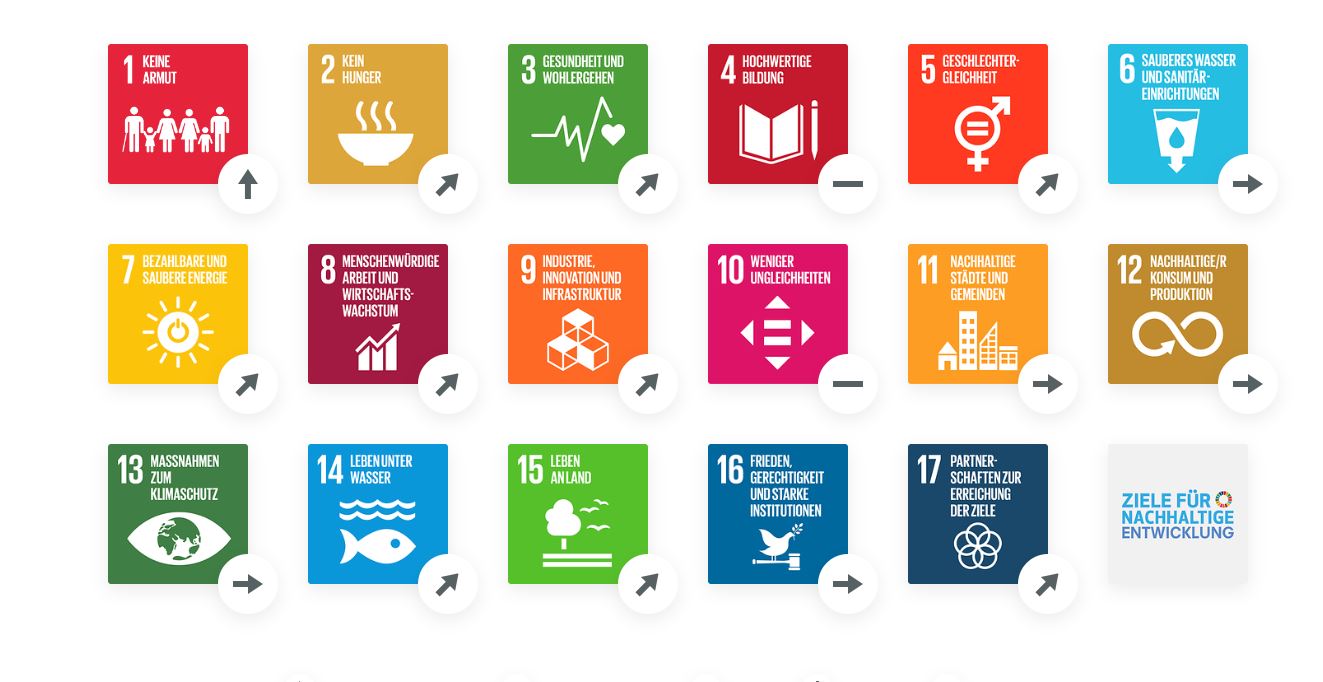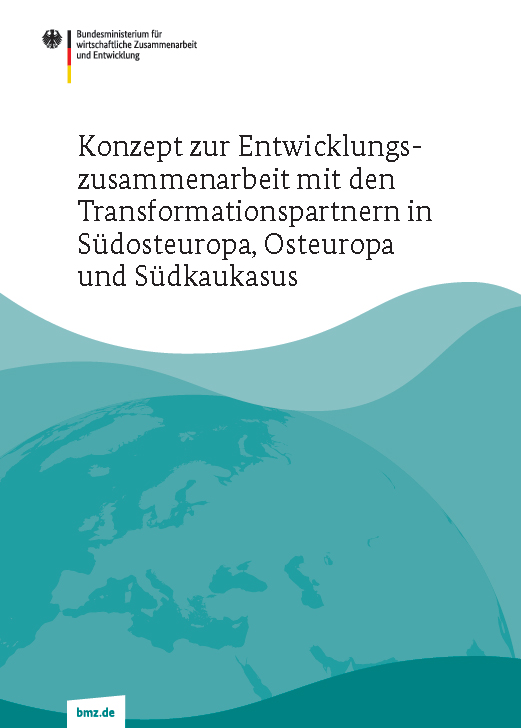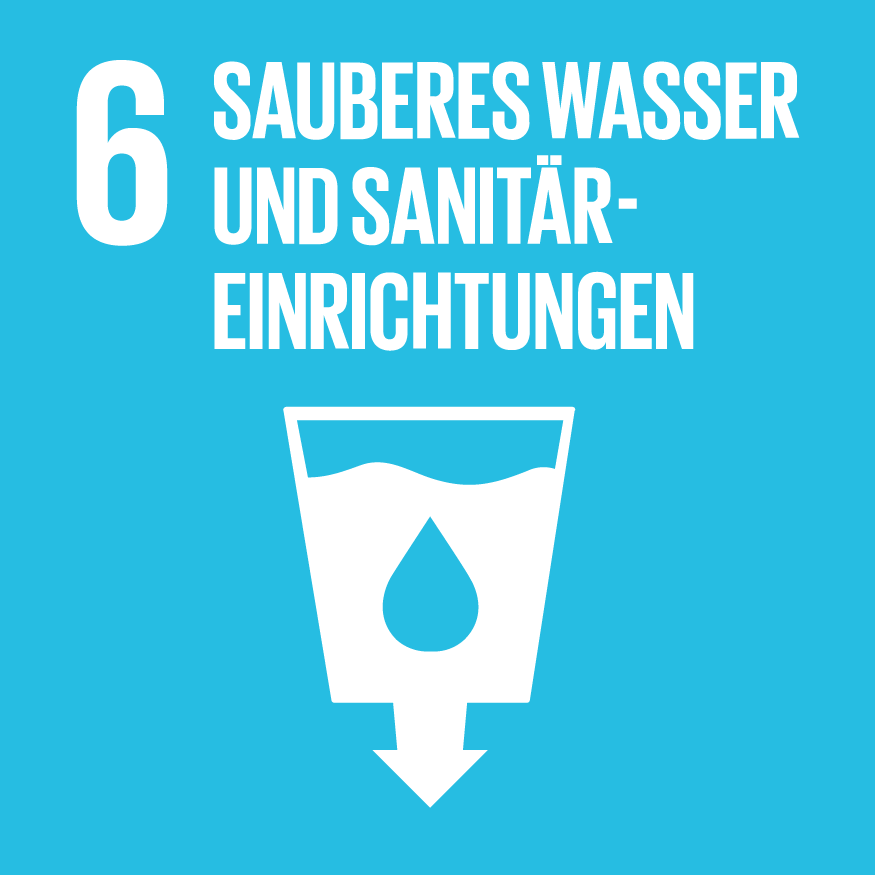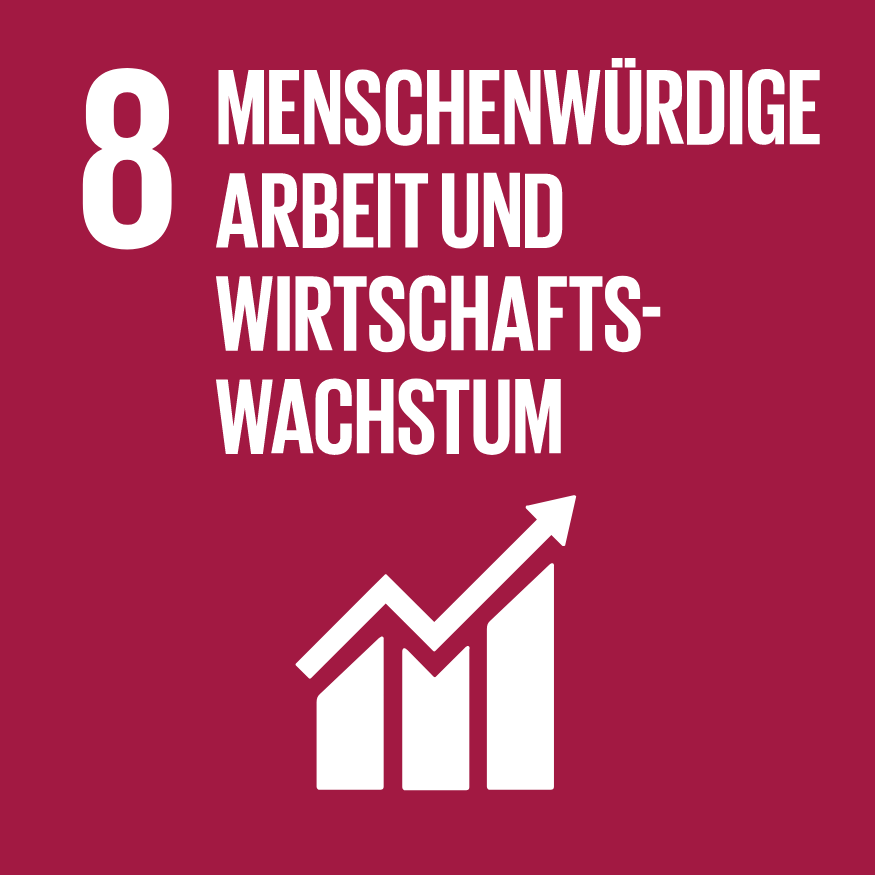Ansicht von Sarajewo bei Sonnenuntergang
Urheberrecht© G Travels, via flickr, CC BY-NC 2.0

Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina liegt im Herzen des Westbalkans. Das Land hat rund 3,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Die Hauptstadt Sarajevo ist ein wichtiges politisches und kulturelles Zentrum in der Region. Nach dem Friedensschluss von 1995 durch das Dayton-Abkommen, das dreieinhalb Jahre Krieg beendete, erzielte Bosnien und Herzegowina wichtige Fortschritte in Sachen politischer Stabilisierung und dem Wiederaufbau der Infrastruktur. Seither ist ein ethisches Prinzip in der Verfassung verankert, das die Konstituierung des souveränen Staates aus drei Völkern festhält: den Bosniaken, den Serben und den Kroaten. So stellt ein dreiköpfiges Staatspräsidium, das aus jeweils einem Vertreter der kroatischen, der muslimischen sowie der serbischen Bosnier besteht, das Staatsoberhaupt dar.
Der Staat Bosnien und Herzegowina setzt sich zusammen aus zwei autonomen Entitäten, der Föderation Bosnien und Herzegowina und der Republika Srpska, sowie dem Sonderdistrikt Brčko. Im Jahr 2016 hat das Land die Mitgliedschaft in der Europäischen Union (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (EU) beantragt. Die Europäische Union hat am 15. Dezember 2022 Bosnien und Herzegowina offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen. Am 21. März 2024 beschloss der Europäische Rat, die Beitrittsverhandlungen aufzunehmen.
Dennoch bleiben politische Blockaden, wirtschaftliche Herausforderungen und gesellschaftliche Spannungen bestehen. Deutschland unterstützt Bosnien und Herzegowina dabei kontinuierlich auf seinem Weg hin zu Stabilität, Wohlstand und einem möglichen EU-Beitritt.
Deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Bosnien und Herzegowina
Die Bundesrepublik ist einer der größten bilateralen Geber und wichtigsten Fürsprecher Bosnien und Herzegowinas in der EU. Die enge Zusammenarbeit mit Deutschland hat den wirtschaftlichen und sozialen Reformprozess unterstützt und den Annäherungsprozess an die Europäische Union vorangebracht. Das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit der EU trat 2015 in Kraft, 2016 beantragte Bosnien und Herzegowina offiziell den Beitritt. Am 21. März 2024 beschloss der Europäische Rat, die Beitrittsverhandlungen aufzunehmen.
Bosnien und Herzegowina ist Transformationspartner (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Deutschland unterstützt das Land bei der EU-Annäherung sowie den erforderlichen rechtlichen und sozioökonomischen Reformen – mit dem Ziel einer funktionierenden Marktwirtschaft, stabilen Strukturen und einer energie- und umweltpolitischen Ausrichtung nach EU-Standards.
Besonders drei Handlungsfelder des BMZ-Reformkonzepts 2030 des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) stehen dabei im Fokus:
- Kernthema: Verantwortung für unseren Planeten – Klima und Energie
Aktionsfelder: Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Erneuerbare Energie und Energieeffizienz, Nachhaltige Stadtentwicklung
- Kernthema: Ausbildung und Nachhaltiges Wachstum für gute Jobs
Aktionsfelder: Berufliche Bildung, Privatsektor- und Finanzsystementwicklung
- Gestaltungsspielraum: Gute Regierungsführung
Im Fall der Republika Srpska entschloss sich das BMZ im Juli 2023 für eine Beendigung der laufenden Infrastrukturvorhaben im Bereich der Finanziellen Zusammenarbeit (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) (FZ). Grund dafür sind die anhaltende Abspaltungspolitik und extreme rhetorische Äußerungen unter dem ehemaligen Präsidenten der Republika Srpska Milorad Dodik.
Entwicklungspolitische Kennzahlen
- Bosnien und Herzegowina
- Deutschland
Allgemeine Informationen
Hinweise für die Nutzung
Klicken Sie sich durch die oben angeordneten verschiedenen Rubriken und finden Sie aktuelle Zahlen aus Bosnien und Herzegowina sowie – zum Vergleich – aus Deutschland.
Weitere Informationen zu den einzelnen Daten und die Quellenangabe können Sie mithilfe des i-Zeichens abrufen.
Gesamtbevölkerung
Erläuterung und Quellenangabe
Die Angabe zur Gesamtbevölkerung basiert auf der faktischen Definition von Bevölkerung, die alle Einwohnerinnen und Einwohner, die in einem Land ansässig sind, unabhängig von ihrem rechtlichen Status oder ihrer Staatsangehörigkeit umfasst. Die Zahlen geben die Schätzungen zur Jahresmitte wieder.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Fläche
Erläuterung und Quellenangabe
Gesamtfläche eines Landes (in Quadratkilometern) einschließlich der Gebiete unter Binnengewässern und einigen Küstenwasserstraßen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Rang im HDI
Erläuterung und Quellenangabe
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) veröffentlicht jährlich einen Bericht über die menschliche Entwicklung. Der darin enthaltene Index der menschlichen Entwicklung (englisch: Human Development Index, HDI) erfasst die durchschnittlichen Werte eines Landes in grundlegenden Bereichen der menschlichen Entwicklung. Dazu gehören zum Beispiel die Lebenserwartung bei der Geburt, das Bildungsniveau sowie das Pro-Kopf-Einkommen. Aus einer großen Zahl solcher Einzelindikatoren wird eine Rangliste errechnet.
Bevölkerung
Gesamtbevölkerung
Erläuterung und Quellenangabe
Die Angabe zur Gesamtbevölkerung basiert auf der faktischen Definition von Bevölkerung, die alle Einwohnerinnen und Einwohner, die in einem Land ansässig sind, unabhängig von ihrem rechtlichen Status oder ihrer Staatsangehörigkeit umfasst. Die Zahlen geben die Schätzungen zur Jahresmitte wieder.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Bevölkerungswachstum
Erläuterung und Quellenangabe
Die jährliche Bevölkerungswachstumsrate (in Prozent) für das Jahr t entspricht der exponentiellen Wachstumsrate der Bevölkerung zur Jahresmitte vom Jahr t-1 bis t in Prozent. Die Angabe zur Gesamtbevölkerung basiert auf der faktischen Definition von Bevölkerung, die alle Einwohnerinnen und Einwohner, die in einem Land ansässig sind, unabhängig von ihrem rechtlichen Status oder ihrer Staatsangehörigkeit umfasst.
Quelle: Globale (Externer Link)Entwicklungsdaten (Externer Link)der Weltbank (Externer Link)
Bevölkerungsdichte
Erläuterung und Quellenangabe
Die Bevölkerungsdichte (Einwohner pro Quadratkilometer) entspricht der Einwohnerzahl zur Jahresmitte dividiert durch Quadratkilometer.
Die Angabe zur Gesamtbevölkerung basiert auf der faktischen Definition von Bevölkerung, die alle Einwohnerinnen und Einwohner, die in einem Land ansässig sind, unabhängig von ihrem rechtlichen Status oder ihrer Staatsangehörigkeit umfasst – mit Ausnahme von Flüchtlingen, die sich im Aufnahmeland nicht dauerhaft niedergelassen haben, da sie allgemein als der Bevölkerung ihres Herkunftslands zugehörig gelten.
Die Landfläche ist die Gesamtfläche eines Landes. Ausgenommen sind die Gebiete unter Binnengewässern, die Hoheitsgebiete über dem Festlandsockel und ausschließliche Wirtschaftszonen. In den meisten Fällen umfasst die Definition von Binnengewässern große Flüsse und Seen.
Quelle: Globale (Externer Link)Entwicklungsdaten (Externer Link)der Weltbank (Externer Link)
Lebenserwartung
Erläuterung und Quellenangabe
Die Lebenserwartung gibt die Zahl der Jahre an, die ein Neugeborenes leben würde, wenn die zum Zeitpunkt seiner Geburt vorherrschenden Sterblichkeitsmuster während seiner gesamten Lebenszeit unverändert blieben.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Menschen, die jünger als 15 sind
Erläuterung und Quellenangabe
Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 0 bis 14 Jahren in Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Angabe zur Gesamtbevölkerung basiert auf der faktischen Definition von Bevölkerung, die alle Einwohnerinnen und Einwohner, die in einem Land ansässig sind, unabhängig von ihrem rechtlichen Status oder ihrer Staatsangehörigkeit umfasst.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Menschen, die 65 oder älter sind
Erläuterung und Quellenangabe
Einwohnerinnen und Einwohner, die 65 Jahre oder älter sind, in Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Angabe zur Gesamtbevölkerung basiert auf der faktischen Definition von Bevölkerung, die alle Einwohnerinnen und Einwohner, die in einem Land ansässig sind, unabhängig von ihrem rechtlichen Status oder ihrer Staatsangehörigkeit umfasst.
Quelle: Globale (Externer Link)Entwicklungsdaten (Externer Link)der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Landbevölkerung
Erläuterung und Quellenangabe
Die Landbevölkerung umfasst die Personen, die gemäß der Definition des nationalen statistischen Amtes in ländlichen Gebieten leben. Sie wird als Differenz zwischen der Gesamtbevölkerung und der städtischen Bevölkerung errechnet.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Stadtbevölkerung
Erläuterung und Quellenangabe
Die Stadtbevölkerung umfasst die Personen, die gemäß der Definition des nationalen statistischen Amtes in städtischen Gebieten leben. Die Daten wurden von der Abteilung für Bevölkerungsfragen der Vereinten Nationen zusammengetragen und bereinigt.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der größten Stadt des Landes
Erläuterung und Quellenangabe
Die Bevölkerung der größten Stadt umfasst die Einwohnerinnen und Einwohner der größten Stadt oder, bei einigen Staaten, des größten Ballungsraums des Landes.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Armut
Anteil der Menschen in extremer Armut
Erläuterung und Quellenangabe
Armutsquote unterhalb von 2,15 US-Dollar am Tag (Kaufkraftparität 2017)
Die Armutsquote entspricht dem Prozentsatz der Bevölkerung, der von weniger als 2,15 US-Dollar am Tag, bei kaufkraftbereinigten Preisen von 2017, lebt. Aufgrund der Aktualisierung der kaufkraftbereinigten Wechselkurse können die Armutsquoten einzelner Länder nicht mit den in früheren Ausgaben angegebenen Armutsquoten verglichen werden.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Menschen unterhalb der nationalen Armutsgrenze
Erläuterung und Quellenangabe
Die nationale Armutsquote entspricht dem Prozentsatz der Bevölkerung, der unterhalb der nationalen Armutsgrenze lebt. Die nationalen Schätzungen beruhen auf den bevölkerungsgewichteten Schätzungen der Untergruppen aus den Haushaltsumfragen. Bei Volkswirtschaften, deren Daten aus der EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) stammen, entspricht das Berichtsjahr dem Einkommensbezugsjahr, das heißt dem Jahr vor dem Erhebungsjahr.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Menschen mit sozialer Absicherung
Erläuterung und Quellenangabe
Die Angabe zur Absicherung durch Sozialversicherungsprogramme gibt den Prozentsatz der Bevölkerung an, der an Programmen teilhat, die beitragsabhängige Altersrenten (einschließlich Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrenten), Sozialversicherungs- und Krankenversicherungsleistungen (einschließlich Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung, Krankengeld, Mutterschaftsgeld und andere Sozialversicherungen) vorsehen. Die Schätzungen berücksichtigen sowohl direkt als auch indirekt Begünstigte.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der prekär Beschäftigten an allen Beschäftigten
Erläuterung und Quellenangabe
Die Angabe zu den schutzbedürftigen Beschäftigungsverhältnissen umfasst die Summe aller selbstständig Erwerbstätigen und unbezahlter, mithelfender Familienmitglieder in Prozent der Erwerbsbevölkerung (modellierte Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO).
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Gini-Koeffizient (Ungleichheit in der Einkommensentwicklung)
Erläuterung und Quellenangabe
Der Gini-Koeffizient gibt an, inwieweit die Einkommensverteilung (oder in einigen Fällen die Verbrauchsausgaben) zwischen Einzelpersonen oder Haushalten innerhalb einer Volkswirtschaft von einer absolut gleichen Verteilung abweicht.
Die Lorenz-Kurve veranschaulicht den kumulativen Prozentsatz des Volkseinkommens gegenüber dem kumulativen Prozentsatz der Einkommensempfänger, ausgehend von den ärmsten Einzelpersonen oder Haushalten. Der Gini-Koeffizient gibt die Abweichung der Lorenz-Kurve von einer theoretischen Geraden der absoluten Gleichheit als Prozentsatz der größten Abweichung unter der Geraden an. Somit steht ein Gini-Koeffizient von 0 % für absolute Gleichheit und von 100 % für absolute Ungleichheit.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Kinder, die arbeiten
Erläuterung und Quellenangabe
Kinder in Arbeitsverhältnissen sind Kinder zwischen 7 und 14 Jahren, die in der Berichtswoche der Erhebung zumindest eine Stunde lang eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt haben.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil von Slumbewohnern an der Stadtbevölkerung
Erläuterung und Quellenangabe
Bei der in Elendsvierteln lebenden Bevölkerung handelt es sich um den prozentualen Anteil der Stadtbevölkerung, die in Slum-Haushalten lebt.
Als Slum-Haushalt wird in den Millenniumsentwicklungszielen eine Gruppe unter demselben Dach lebender Personen bezeichnet, denen es an einer oder mehreren der folgenden Voraussetzungen fehlt: Zugang zu verbessertem Trinkwasser, Zugang zu verbesserter Sanitärversorgung, ausreichender Wohnfläche, einer haltbaren und vor einer Zwangsräumung geschützten, dauerhaften Behausung.
In der Folge wurde in den Zielen für nachhaltige Entwicklung (11.1.1) die vorstehende Definition von Elendsvierteln/informellen Siedlungen um schlechte Wohnverhältnisse (Erschwinglichkeit von Wohnraum) ergänzt.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Ernährung
Anteil der unterernährten Menschen
Erläuterung und Quellenangabe
Die Häufigkeit von Unterernährung wird als Prozentsatz der Bevölkerung angegeben, dessen gewöhnliche Ernährung nicht ausreicht, um die Nahrungsversorgung, die für die Führung eines normalen aktiven und gesunden Lebens erforderlich ist, sicherzustellen. Bei der Angabe von 2,5 kann die Häufigkeit der Unterernährung auch unter 2,5 % betragen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der unter fünf Jahre alten Kinder mit Untergewicht
Erläuterung und Quellenangabe
Bei der Häufigkeit von Untergewicht bei Kindern ist der Prozentsatz der Kinder unter 5 Jahren angegeben, deren Gewicht für ihr Alter mehr als zwei Standardabweichungen unter dem Mittelwert für die internationale Bezugsbevölkerung von 0 bis 59 Monaten liegt. Die Angaben stützen sich auf die 2006 veröffentlichten WHO-Standards für Kinderwachstum.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Menschen in stark ernährungsunsicheren Haushalten
Erläuterung und Quellenangabe
Prozentsatz der Personen in der Bevölkerung, die in Haushalten leben, die als stark ernährungsunsicher gelten. Ein Haushalt gilt als stark ernährungsunsicher, wenn mindestens ein Erwachsener im Haushalt angibt, während des Jahres häufiger unterschiedliche, sehr schlechte Erfahrungen, wie sie im Fragebogen der Skala für erlebte Ernährungsunsicherheit (FIES) aufgeführt sind, gemacht zu haben. Dazu gehört beispielsweise gezwungen gewesen zu sein, die Essensmenge zu verringern, Mahlzeiten auszulassen, zu hungern oder wegen fehlender Mittel einen ganzen Tag lang nichts gegessen zu haben.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Lebensmittelimporte
Erläuterung und Quellenangabe
Die Nahrungsmitteleinfuhren umfassen die Waren im Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel Teil 0 (Nahrungsmittel und lebende Tiere), Teil 1 (Getränke und Tabak) und Teil 4 (tierische und pflanzliche Öle, Fette und Wachse) sowie Abschnitt 22 (Ölsaaten und ölhaltige Früchte).
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft
Erläuterung und Quellenangabe
Erwerbstätigkeit in der Landwirtschaft (modellierte Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO) umfasst Personen im erwerbsfähigen Alter, die gegen Entgelt einer beruflichen Tätigkeit zur Produktion von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen nachgehen, unabhängig davon, ob sie während des Berichtszeitraums gearbeitet oder aufgrund einer befristeten Abwesenheit vom Arbeitsplatz oder Arbeitszeitregelung nicht gearbeitet haben.
Der Agrarsektor umfasst gemäß der Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC) Abteilung 1 (ISIC 2), Abschnitt A-B (ISIC 3) oder Abschnitt A (ISIC 4) Tätigkeiten in der Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Fischerei.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche an der gesamten Landfläche
Erläuterung und Quellenangabe
Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist der Anteil der Landfläche, bei der es sich um Ackerflächen, als Dauerkultur genutzte Flächen und Dauergrünland handelt.
Ackerflächen sind laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) als Kulturflächen (Flächen mit zwei Kulturen pro Jahr werden einfach gezählt), Wechselweideflächen zum Mähen oder Weiden, Nutz- oder Küchengärten und vorübergehendes Brachland definierte Flächen. Aufgrund des Wanderfeldbaus komplett aufgegebene Flächen sind davon ausgenommen.
Auf als Dauerkultur genutzten Flächen werden Kulturpflanzen angebaut, die wie Kakao, Kaffee und Naturkautschuk für einen langen Zeitraum auf den Flächen wachsen und nicht nach jeder Ernte neu angepflanzt werden müssen. Zu dieser Kategorie gehören Flächen unter blühenden Büschen, Obstbäumen, Nussbäumen und Weinstöcken, aber nicht die Flächen unter zur Holzgewinnung angebauten Bäumen.
Dauergrünland sind Flächen, die mindestens fünf Jahre für Grünfutter einschließlich Naturfutter und Kulturpflanzen genutzt werden.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Ackerland
Erläuterung und Quellenangabe
Ackerflächen sind laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) Kulturflächen (Flächen mit zwei Kulturen pro Jahr werden einfach gezählt), Wechselweideflächen zum Mähen oder Weiden, Nutz- oder Küchengärten und vorübergehendes Brachland. Aufgrund des Wanderfeldbaus komplett aufgegebene Flächen sind davon ausgenommen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Gleichberechtigung
Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen
Erläuterung und Quellenangabe
Der Prozentsatz der weiblichen Erwerbstätigen in der Erwerbsbevölkerung gibt an, wie groß der Anteil der erwerbstätigen Frauen ist. Die Erwerbsbevölkerung umfasst Personen ab dem Alter von 15 Jahren und älter, die während eines bestimmten Zeitraums ihre Arbeitskraft zur Leistungserstellung zur Verfügung stellen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Stunden am Tag, die Frauen mit unbezahlter Arbeit im Haushalt und in der Pflege verbringen
Erläuterung und Quellenangabe
Die Zeit, die Frauen durchschnittlich für unbezahlte Betreuungs-, Pflege- und Hausarbeit sowie für haushaltsnahe Dienstleistungen zur Selbstversorgung aufbringen.
Die Angaben beziehen sich auf den prozentualen Anteil der Stunden am Tag. Betreuungs-, Pflege- und Hausarbeit umfasst unter anderem die Zubereitung von Lebensmitteln, das Geschirrspülen, die Reinigung und Instandhaltung einer Unterkunft, das Wäschewaschen und Bügeln, die Gartenarbeit, die Versorgung von Haustieren, den Einkauf, die Anbringung, Bedienung und Instandsetzung von persönlichen und Haushaltsgegenständen, die Kinderbetreuung und die Pflege von kranken, älteren und behinderten Haushaltsmitgliedern.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Frauen (15–49 Jahre) mit Genitalverstümmelung
Erläuterung und Quellenangabe
Der Prozentsatz der Frauen von 15 bis 49 Jahren, deren äußeres Genital teilweise oder vollständig entfernt wurde oder deren Genitalien aus kulturellen oder anderen nicht-therapeutischen Gründen anderweitig verletzt wurden.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der 15–49 Jahre alten Frauen, die ihre eigenen informierten Entscheidungen bezüglich sexueller Beziehungen, der Verwendung von Verhütungsmitteln und der reproduktionsmedizinischen Versorgung treffen
Erläuterung und Quellenangabe
Der Anteil der Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren (verheiratet oder zusammenlebend), die in drei Bereichen ihre eigenen informierten Entscheidungen treffen, das heißt: die den Geschlechtsverkehr mit ihrem Ehemann oder Partner auf eigenen Wunsch verweigern, selbst über die Verwendung von Verhütungsmitteln und die eigene Gesundheitsversorgung entscheiden können. Nur Frauen, die bei allen drei Bereichen mit „Ja“ antworten können, gelten als Frauen, die „ihre eigenen Entscheidungen betreffend sexuelle Beziehungen und die Verwendung von Verhütungsmitteln treffen“.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Frauen, die im Alter von 18 Jahren erstmals verheiratet waren
Erläuterung und Quellenangabe
Prozentsatz der Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren, die im Alter von 18 Jahren erstmals verheiratet waren.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Firmen mit weiblichen Führungskräften
Erläuterung und Quellenangabe
Unternehmen mit weiblichen Führungskräften umfassen den Prozentsatz der Unternehmen im Privatsektor, unter deren Führungskräften sich Frauen befinden. „Führungskraft“ bezieht sich auf Angestellte in der höchsten leitenden Position oder den oder die Hauptgeschäftsführer/in des Unternehmens. Bei dieser Person kann es sich um die Eigentümerin oder den Eigentümer handeln, wenn diese Person in leitender Position für das Unternehmen arbeitet. Die Ergebnisse entstammen Erhebungen in mehr als 100.000 Privatunternehmen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Frauen in nationalen Parlamenten
Erläuterung und Quellenangabe
Der Anteil der Sitze, die Frauen in nationalen Parlamenten innehaben, gibt den Prozentsatz der Parlamentssitze an, den Frauen im Parlament oder der Abgeordnetenkammer innehaben.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Klima
Kohlendioxidemission pro Kopf
Erläuterung und Quellenangabe
Gesamte Kohlendioxidemissionen pro Jahr aus den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Abfall und Industrie, ausgenommen Emissionen durch Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF), umgerechnet in CO₂-Äquivalente dividiert durch die Bevölkerung des Landes. CO₂ ist eines der sechs im Kyoto-Protokoll erfassten Treibhausgase (THG). Dieser Wert schließt THG-Flüsse nicht ein, die durch LULUCF verursacht werden, da für diese Flüsse größere Unsicherheiten gelten.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Gesamte Treibhausgasemissionen
Erläuterung und Quellenangabe
Veränderung der Emissionen im laufenden Jahr gegenüber Referenzjahr 1990 (in Prozent), CO₂-Emissionen aus den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Abfall und Industrie, ausgenommen Emissionen durch Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF). Dem Wert liegt eine Umrechnung in CO₂-Äquivalente zugrunde. Negative Werte bedeuten, dass die Emissionen in einem Jahr unter dem Wert von 1990 liegen. Dieser Wert schließt THG-Flüsse nicht ein, die durch LULUCF verursacht werden, da für diese Flüsse größere Unsicherheiten gelten.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Methanemissionen
Erläuterung und Quellenangabe
Methanemissionen entstehen durch menschliche Aktivitäten wie die Landwirtschaft und durch die industrielle Methanproduktion.
Maß für die jährlichen Emissionen von Methan (CH₄) aus den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Abfall und Industrie, ausgenommen LULUCF. Dem Wert liegt eine Umrechnung in CO₂-Äquivalente zu Grunde.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Landwirtschaftliche Methanemissionen pro Jahr
Erläuterung und Quellenangabe
Maß für die jährlichen Emissionen von Methan (CH₄) aus der Landwirtschaft. Landwirtschaftliche Methanemissionen entstehen durch Emissionen von Tieren, tierische Abfälle, den Reisanbau, das Verbrennen von landwirtschaftlichen Abfällen (nichtenergetisch, vor Ort) und das Abbrennen von Steppe.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Bevölkerung in Gebieten mit einer Höhe von weniger als fünf Metern über dem Meeresspiegel
Erläuterung und Quellenangabe
Prozentsatz der Gesamtbevölkerung, der in Gebieten mit einer Höhe von weniger als fünf Metern über dem Meeresspiegel lebt.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Stromproduktion aus Öl, Gas und Kohle
Erläuterung und Quellenangabe
Die Angabe zur Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kohlevorkommen bezieht sich auf die zur Erzeugung von Elektrizität eingesetzten Produktionsmittel. Öl bezieht sich auf Rohöl und Mineralölerzeugnisse. Gas bezieht sich auf Erdgas, davon ausgenommen sind aber Erdgaskondensate. Kohle bezieht sich auf alle Kohle- und Braunkohlesorten und sowohl primäre (einschließlich Steinkohle und Braunkohle) als auch sekundäre Brennstoffe (einschließlich Patentbrennstoffe, Koksofenkoks, Kokereigas und Hochofengas). Zu dieser Kategorie gehört auch Torf.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Umwelt
Anteil der Naturschutzgebiete an der gesamten Landfläche
Erläuterung und Quellenangabe
Naturschutzgebiete sind vollständig oder teilweise geschützte, mindestens 1.000 Hektar große, von den nationalen Behörden als der wissenschaftlichen Forschung vorbehaltene Habitate mit beschränktem öffentlichem Zugangsrecht, Nationalparks, Naturdenkmäler, Naturreservate oder Wildschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und zur nachhaltigen Nutzung bestimmte Gebiete. Meeresgebiete, offen zugängliche Gebiete, Flachwasser (Gezeitenbereiche) und durch Ortsrecht oder Landesgesetze geschützte Gebiete sind davon ausgenommen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Meeresschutzgebiete an den Hoheitsgewässern
Erläuterung und Quellenangabe
Meeresschutzgebiete sind Gebiete der Gezeitenbereiche oder der unteren Gezeitenzone – mit dem darüber befindlichen Wasser und der dazugehörigen Flora und Fauna und historischen und kulturellen Merkmalen –, die durch Gesetze oder andere wirksame Maßnahmen für den Schutz der umschlossenen Umwelt oder Teilen davon bestimmt sind.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Waldfläche an der gesamten Landfläche
Erläuterung und Quellenangabe
Als Waldfläche gilt eine Landfläche mit einem natürlichen oder angepflanzten Bestand an Bäumen, die mindestens 5 Meter hoch sind, unabhängig von ihrer Produktivität. Ausgenommen sind Baumbestände innerhalb landwirtschaftlicher Produktionssysteme (wie beispielsweise in Obstplantagen und Waldfeldbausystemen) und Bäume in städtischen Parks und Gärten.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche an der gesamten Landfläche
Erläuterung und Quellenangabe
Als landwirtschaftliche Nutzfläche gilt der Anteil der Landfläche, bei der es sich um Ackerflächen, als Dauerkultur genutzte Flächen und Dauergrünland handelt.
Ackerflächen sind laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) als Kulturflächen (Flächen mit zwei Kulturen pro Jahr werden einfach gezählt), Wechselweideflächen zum Mähen oder Weiden, Nutz- oder Küchengärten und vorübergehendes Brachland definierte Flächen. Aufgrund des Wanderfeldbaus komplett aufgegebene Flächen sind davon ausgenommen.
Auf als Dauerkultur genutzten Flächen werden Kulturpflanzen angebaut, die wie Kakao, Kaffee und Naturkautschuk für einen langen Zeitraum auf den Flächen wachsen und nicht nach jeder Ernte neu gepflanzt werden müssen. Zu dieser Kategorie gehören Flächen unter blühenden Büschen, Obstbäumen, Nussbäumen und Weinstöcken, aber keine Flächen unter zur Holzgewinnung angebauten Bäumen.
Dauergrünland sind Flächen, die mindestens fünf Jahre für Grünfutter einschließlich Naturfutter und Kulturpflanzen genutzt werden.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Luftverschmutzung: Anteil der Bevölkerung, der Luftverschmutzung oberhalb des WHO-Grenzwertes ausgesetzt ist
Erläuterung und Quellenangabe
Der Anteil der Bevölkerung, der einer Einwirkung von Feinstaub mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometer (PM-2,5-Immissionen ) ausgesetzt ist, die oberhalb des WHO-Richtwerts liegt, ist definiert als der Bevölkerungsanteil eines Landes, der an Orten lebt, wo die mittleren jährlichen PM-2,5-Immissionen über 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft betragen.
10 Mikrogramm ist der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene untere Richtwert für derartige Immissionen. Oberhalb dieses Richtwerts wurden Beeinträchtigungen der Gesundheit aufgrund von PM-2,5-Belastungen beobachtet.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Verbrauch an erneuerbaren Energien
Erläuterung und Quellenangabe
Der Verbrauch an erneuerbaren Energien ist der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil von Slumbewohnern an der Stadtbevölkerung
Erläuterung und Quellenangabe
Bei der in Elendsvierteln lebenden Bevölkerung handelt es sich um den prozentualen Anteil der Stadtbevölkerung, die in Slum-Haushalten lebt.
Als Slum-Haushalt wird in den Millenniumsentwicklungszielen eine Gruppe unter demselben Dach lebender Personen bezeichnet, denen es an einer oder mehreren der folgenden Voraussetzungen fehlt: Zugang zu verbessertem Trinkwasser, Zugang zu verbesserter Sanitärversorgung, ausreichender Wohnfläche, einer haltbaren und vor einer Zwangsräumung geschützten, dauerhaften Behausung.
In der Folge wurde in den Zielen für nachhaltige Entwicklung (11.1.1) die vorstehende Definition von Elendsvierteln/informellen Siedlungen um schlechte Wohnverhältnisse (Erschwinglichkeit von Wohnraum) ergänzt.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Gesundheit
Lebenserwartung
Erläuterung und Quellenangabe
Die Lebenserwartung gibt die Zahl der Jahre an, die ein Neugeborenes leben würde, wenn die zum Zeitpunkt seiner Geburt vorherrschenden Sterblichkeitsmuster während seiner gesamten Lebenszeit unverändert blieben.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Laufende Gesundheitsausgaben
Erläuterung und Quellenangabe
Die Angabe zur Höhe der laufenden Gesundheitsausgaben als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts beruht auf Schätzungen der laufenden Gesundheitsausgaben. Sie beziehen sich auf die während eines Jahres nachgefragten Gesundheitsgüter und -leistungen. Nicht berücksichtigt werden dabei Investitionsausgaben im Gesundheitssektor wie für Gebäude, Geräte, Informationstechnik und Bestände an Impfstoffen für Notfälle und Ausbruchsgeschehen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anzahl der Ärztinnen und Ärzte
Erläuterung und Quellenangabe
Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte umfasst sowohl Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner als auch niedergelassene Fachärzte und -ärztinnen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anzahl der Krankenhausbetten
Erläuterung und Quellenangabe
Als Krankenhausbetten gelten Stationsbetten in öffentlichen, privaten, allgemeinen und Fachkrankenhäusern und Rehabilitationszentren. In den meisten Fällen gehören dazu die Betten für die Versorgung sowohl von akut als auch chronisch Kranken.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anzahl der Krankenpflegerinnen und -pfleger und Hebammen
Erläuterung und Quellenangabe
Zu den Gesundheits- und Krankenpflegekräften und Hebammen gehören professionelle Pflegekräfte, Hebammen, Pflegehelferinnen und -helfer, Hebammenhelferinnen, examinierte Krankenpflegekräfte, examinierte Hebammen und weiteres beigeordnetes Personal wie Zahnarzthelfer und -helferinnen und Pflegepersonal für die Erstversorgung.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anzahl der Kinder, die vor ihrem fünften Geburtstag sterben
Erläuterung und Quellenangabe
Die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf Jahren bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neugeborenes pro 1.000 vor Vollendung des fünften Lebensjahrs stirbt, vorausgesetzt die altersspezifischen Sterblichkeitsraten des jeweiligen Jahres werden zugrunde gelegt.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anzahl der Mütter, die während der Schwangerschaft oder bei der Geburt ihres Kindes sterben
Erläuterung und Quellenangabe
Die Müttersterblichkeitsrate ist die Zahl der Frauen, die pro 100.000 Lebendgeburten während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach ihrer Beendigung an durch die Schwangerschaft bedingten Ursachen sterben.
Die Daten werden anhand eines Regressionsmodells geschätzt. Das Modell verwendet Informationen über den Anteil der Müttersterblichkeit bei nicht an Aids gestorbenen Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren, über die Fruchtbarkeit, über die die Geburt betreuenden Personen und über das Bruttoinlandsprodukt unter Berücksichtigung der Kaufkraftparitäten.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Geburten mit Betreuung durch ausgebildetes medizinisches Personal
Erläuterung und Quellenangabe
Prozentsatz der Geburten, die von Personal betreut werden, das dazu ausgebildet wurde, die erforderliche Aufsicht, Betreuung und Beratung der Frauen während der Schwangerschaft, der Wehen und nach der Geburt durchzuführen, Geburten alleine zu begleiten und Neugeborene zu versorgen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Kleinkinder (12–23 Monate alt) mit Impfung gegen Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus
Erläuterung und Quellenangabe
Prozentsatz der Kinder im Alter von 12 bis 23 Monaten, die 12 Monate zuvor oder zu irgendeiner Zeit vor der Erhebung gegen Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus geimpft wurden. Ein Kind gilt als ausreichend gegen Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus immunisiert, nachdem ihm in zeitlichen Abständen drei Dosen an Impfstoff verabreicht wurden.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
HIV/Aids-Quote
Erläuterung und Quellenangabe
Die Häufigkeit von HIV/Aids bezieht sich auf den Prozentsatz der Personen im Alter von 15 bis 49 Jahren, die mit HIV infiziert sind.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Bildung
Anteil der Menschen, die lesen und schreiben können
Erläuterung und Quellenangabe
Die Alphabetisierungsrate der Erwachsenen gibt den Prozentsatz der Personen im Alter von 15 Jahren und älter an, die sowohl lesen als auch schreiben und kurze und einfache Beschreibungen des eigenen Alltagslebens verstehen können.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der grundschulpflichtigen Kinder, der zur Schule geht
Erläuterung und Quellenangabe
Die Netto-Einschulungsrate gibt den Anteil der eine Schule besuchenden Kinder im schulpflichtigen Alter an der Bevölkerung im jeweiligen schulpflichtigen Alter an.
[Im Gegensatz dazu gibt die hier nicht genannte Brutto-Einschulungsrate den Anteil der eingeschulten Schüler einer Bildungsstufe zu der Gesamtbevölkerung der für diese Stufe relevanten Altersgruppe an. Dabei werden auch eingeschulte Schüler berücksichtigt, die eigentlich zu jung oder zu alt für diese Stufe sind. Dadurch kann es zu einer Brutto-Einschulungsrate von über 100 Prozent kommen. Die Netto-Einschulungsrate kann dann entsprechend niedriger liegen.]
Die Grundschulbildung vermittelt Kindern die Grundlagen des Lesens, Schreibens und Rechnens sowie ein Grundverständnis in Fächern wie Geschichte, Geografie, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Kunst und Musik.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Zahl der Grundschulkinder pro Lehrkraft
Erläuterung und Quellenangabe
Die Schüler-Lehrer-Relation im Primarbereich ist die durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern je Lehrkraft im Grundschulbereich.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Schulbesuchsrate bei Mädchen an weiterführenden Schulen
Erläuterung und Quellenangabe
Die Netto-Schulbesuchsrate gibt den Anteil der eine Schule besuchenden Kinder im schulpflichtigen Alter an der Bevölkerung im jeweiligen schulpflichtigen Alter an.
Die Sekundarbildung vervollständigt die im Primarbereich begonnene Vermittlung der Grundbildung und hat zum Ziel, mithilfe von mehr Fachlehrern durch das Angebot von mehr an Themen oder Fertigkeiten orientiertem Unterricht die Grundlagen für ein lebenslanges Lernen und die menschliche Entwicklung zu schaffen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Schulbesuchsrate bei Jungen an weiterführenden Schulen
Erläuterung und Quellenangabe
Die Netto-Schulbesuchsrate gibt den Anteil der eine Schule besuchenden Kinder im schulpflichtigen Alter an der Bevölkerung im jeweiligen schulpflichtigen Alter an.
Die Sekundarbildung vervollständigt die im Primarbereich begonnene Vermittlung der Grundbildung und hat zum Ziel, mithilfe von mehr Fachlehrern durch das Angebot von mehr an Themen oder Fertigkeiten orientiertem Unterricht die Grundlagen für ein lebenslanges Lernen und die menschliche Entwicklung zu schaffen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Zahl der Sekundarschülerinnen und -schüler pro Lehrkraft
Erläuterung und Quellenangabe
Die Schüler-Lehrer-Relation im Sekundarbereich ist die durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern je Lehrkraft im Sekundarschulbereich.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der jungen Erwachsenen, der eine Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie besucht
Erläuterung und Quellenangabe
Die Brutto-Einschulungsquote ist das Verhältnis der Gesamteinschreibungen, unabhängig vom Alter, zur Bevölkerung der Altersgruppe, die offiziell dem angegebenen Bildungsniveau entspricht.
Die Tertiärbildung, unabhängig davon, ob sie zu weiterführenden forschungsorientierten Studien führt, erfordert normalerweise als Mindestzugangsvoraussetzung den erfolgreichen Abschluss des Sekundarbereichs.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Öffentliche Ausgaben für Bildung
Erläuterung und Quellenangabe
Die öffentlichen Ausgaben für Bildung (laufende Ausgaben, Kapitalausgaben und Transfers) werden als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts angegeben. Sie umfassen auch Ausgaben, die durch Transfers aus internationalen Quellen an den Staat finanziert werden.
„Öffentliche Ausgaben“ bezieht sich in der Regel auf die Ausgaben der lokalen, regionalen und zentralen Regierungen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Ausgaben für Forschung und Entwicklung
Erläuterung und Quellenangabe
Bruttoinlandsausgaben für Forschung und Entwicklung, angegeben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Berücksichtigt sind sowohl laufende Ausgaben als auch Kapitalkosten in den vier Hauptbereichen: Wirtschaft, Staat, Hochschulen und private Institutionen ohne Erwerbszweck.
Der Bereich Forschung und Entwicklung umfasst Grundlagenforschung, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Infrastruktur
Anteil der Internetnutzer
Erläuterung und Quellenangabe
Internetnutzer sind Einzelpersonen, die in den letzten drei Monaten das Internet (von einem beliebigen Ort aus) genutzt haben. Das Internet kann zum Beispiel über Rechner, Mobiltelefone, persönliche digitale Assistenten, Spielgeräte, digitale Fernsehgeräte genutzt worden sein.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Bevölkerung mit angemessenem Anschluss an eine Trinkwasserversorgung
Erläuterung und Quellenangabe
Der Prozentsatz der Personen, die Trinkwasser aus einer verbesserten, vor Ort zugänglichen Trinkwasserquelle nutzen, die bei Bedarf verfügbar ist und keine Verunreinigungen durch Fäkalien und vorrangige chemische Stoffe aufweist.
Als verbesserte Trinkwasserquellen gelten unter anderem Wasserleitungen, Bohr- oder Rohrbrunnen, geschützte Schachtbrunnen, geschützte Quellen sowie abgefülltes oder geliefertes Wasser.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Bevölkerung mit angemessenem Anschluss an eine Sanitärversorgung
Erläuterung und Quellenangabe
Der Prozentsatz der Personen, die verbesserte Sanitäreinrichtungen nutzen, die sie nicht mit anderen Haushalten teilen und bei denen die menschlichen Ausscheidungen an Ort und Stelle sicher entsorgt oder abtransportiert und an einem anderen Ort behandelt werden.
Als verbesserte Sanitäreinrichtungen gelten zum Beispiel Spültoiletten mit Anschluss an die Kanalisation, Klärgruben, belüftete verbesserte Grubenlatrinen; Kompostiertoiletten oder Grubenlatrinen mit Abdeckplatte.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu Elektrizität
Erläuterung und Quellenangabe
Zugang zu Elektrizität bezieht sich auf den Prozentsatz der Bevölkerung mit Zugang zu Elektrizität.
Die Daten zur Elektrifizierung stammen von der Industrie, aus nationalen Umfragen und internationalen Quellen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anzahl der Mobilfunkverträge
Erläuterung und Quellenangabe
Mobilfunkverträge sind Verträge mit einem öffentlichen Mobiltelefondienst, der unter Verwendung von Mobilfunktechnik den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz zur Verfügung stellt.
Der Indikator beinhaltet die (und ist aufgeteilt nach der) Anzahl von Verträgen mit nachträglicher Abrechnung und Anzahl aktiver Konten mit vorausbezahlter Guthabenkarte (die während der vorangegangenen drei Monate genutzt wurden).
Der Indikator gilt für alle Mobilfunkverträge, die sprachliche Kommunikationsdienste anbieten. Nicht berücksichtigt wurden Verträge für Datenkarten oder USB-Modems, öffentlichen mobilen Datenfunk, privaten Bündelfunk, Telepoint-Dienste, Funkruf- und Telemetriedienste.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Von Zugpassagieren im Schienenverkehr insgesamt zurückgelegte Personenkilometer
Erläuterung und Quellenangabe
Die Angabe zu den Personenkilometern ist eine Kennzahl für die Transportleistung im Schienenverkehr. Um die Zahl zu erhalten, wird die Zahl der beförderten Fahrgäste mit der Zahl der dabei insgesamt gefahrenen Kilometer multipliziert. Ein Personenkilometer entspricht dadurch der Beförderung eines Passagiers über einen Kilometer.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Energie
Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu Elektrizität
Erläuterung und Quellenangabe
Zugang zu Elektrizität bezieht sich auf den Prozentsatz der Bevölkerung mit Zugang zu Elektrizität.
Die Daten zur Elektrifizierung stammen von der Industrie, aus nationalen Umfragen und internationalen Quellen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Stromverbrauch pro Person
Erläuterung und Quellenangabe
Der Stromverbrauch umfasst die Leistung der Kraftwerke und der Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung abzüglich der Übertragungs-, Verteilungs- und Umwandlungsverluste und des Eigenverbrauchs der Kraftwerke.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Energieimporte am gesamten Energieverbrauch
Erläuterung und Quellenangabe
Die Nettoenergieeinfuhren werden geschätzt als Energieverbrauch abzüglich der Energieerzeugung, beides in Erdöleinheiten gemessen.
Ein negativer Wert weist darauf hin, dass das Land ein Nettoexporteur ist.
Der Energieverbrauch bezieht sich auf den Einsatz von Primärenergie vor der Umwandlung in andere Endverbrauchs-Kraftstoffe. Er entspricht der heimischen Energieproduktion zuzüglich Einfuhren und Vorratsveränderungen und abzüglich Ausfuhren und der Kraftstoffe für Schiffe und Flugzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamtstromerzeugung
Erläuterung und Quellenangabe
Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamtstromerzeugung umfasst den Anteil am insgesamt in allen Anlagen erzeugten Strom, der mit Kraftwerken erzeugt ist, die erneuerbare Energiequellen nutzen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Energie aus fossilen Brennstoffen am Gesamtenergieverbrauch
Erläuterung und Quellenangabe
Als fossile Brennstoffe gelten Kohle, Erdöl, Erdölprodukte und Erdgasprodukte.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu sauberen Brennstoffen und umweltfreundlichen Technologien zum Kochen
Erläuterung und Quellenangabe
Zugang zu sauberen Brennstoffen und umweltfreundlichen Technologien zum Kochen stellt den Anteil der Gesamtbevölkerung dar, der zum Kochen in erster Linie saubere Brennstoffe und umweltfreundliche Technologien nutzt.
Gemäß den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört Kerosin nicht zu den sauberen Brennstoffen zum Kochen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Wirtschaft
Bruttonationaleinkommen pro Jahr
Erläuterung und Quellenangabe
Das Bruttonationaleinkommen (vormals Bruttosozialprodukt) ist die Summe der von allen Inländern erwirtschafteten Wertschöpfung zuzüglich aller Gütersteuern (abzüglich Subventionen), die nicht bei der Berechnung des Produktionswerts berücksichtigt werden, und zuzüglich der Nettoeinnahmen aus Primäreinkommen im Ausland (Arbeitnehmerentgelte und Einnahmen aus Grundbesitz).
Die Angaben erfolgen in US-Dollar Nominalwert. Das in der Landeswährung berechnete Bruttonationaleinkommen wird in der Regel aus Gründen der Vergleichbarkeit der Volkswirtschaften zum offiziellen Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet; allerdings wird ein alternativer Kurs verwendet, wenn die Auffassung herrscht, dass der offizielle Wechselkurs von dem in internationalen Transaktionen tatsächlich verwendeten Kurs außergewöhnlich stark abweicht.
Um den Einfluss von Preis- und Wechselkursschwankungen zu mildern, verwendet die Weltbank zur Umrechnung die Atlas-Methode. Zu Hilfe genommen wird dabei ein Umrechnungsfaktor, der sich am durchschnittlichen Wechselkurs eines bestimmten Jahres und der beiden vorangegangenen Jahre orientiert. Er wird um die Unterschiede zwischen den Inflationsraten des Landes und bis 2000 in den G5-Staaten (Frankreich, Deutschland, Japan, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika) bereinigt. Seit 2001 gehören zu diesen Ländern das Euro-Währungsgebiet, Japan, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Bruttonationaleinkommen pro Kopf pro Jahr
Erläuterung und Quellenangabe
Zur Berechnung des jährlichen Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommens (vormals Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt) wird gemäß der Atlas-Methode der Weltbank das in US-Dollar umgerechnete Bruttonationaleinkommen durch die Gesamtbevölkerung zur Jahresmitte dividiert.
Das Bruttonationaleinkommen (vormals Bruttosozialprodukt) ist die Summe der von allen Inländern erwirtschafteten Wertschöpfung zuzüglich aller Gütersteuern (abzüglich Subventionen), die nicht bei der Berechnung des Produktionswerts berücksichtigt werden, und zuzüglich der Nettoeinnahmen aus Primäreinkommen im Ausland (Arbeitnehmerentgelte und Einnahmen aus Grundbesitz).
Die Angaben erfolgen in US-Dollar Nominalwert. Das in der Landeswährung berechnete Bruttonationaleinkommen wird in der Regel aus Gründen der Vergleichbarkeit der Volkswirtschaften zum offiziellen Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet; allerdings wird ein alternativer Kurs verwendet, wenn die Auffassung herrscht, dass der offizielle Wechselkurs von dem in internationalen Transaktionen tatsächlich verwendeten Kurs außergewöhnlich stark abweicht.
Um den Einfluss von Preis- und Wechselkursschwankungen zu mildern, verwendet die Weltbank zur Umrechnung die Atlas-Methode. Zu Hilfe genommen wird dabei ein Umrechnungsfaktor, der sich am durchschnittlichen Wechselkurs eines bestimmten Jahres und der beiden vorangegangenen Jahre orientiert. Er wird um die Unterschiede zwischen den Inflationsraten des Landes und bis 2000 in den G5-Staaten (Frankreich, Deutschland, Japan, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika) bereinigt. Seit 2001 gehören zu diesen Ländern das Euro-Währungsgebiet, Japan, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Wirtschaftswachstum pro Jahr
Erläuterung und Quellenangabe
Die jährliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen auf der Grundlage einer konstanten Landeswährung. Die Aggregate beziehen sich auf konstante Preise im Jahr 2015, umgerechnet in US-Dollar.
Das Bruttoinlandsprodukt entspricht der Summe der von allen Inländern erwirtschafteten Bruttowertschöpfung zuzüglich aller Gütersteuern und abzüglich Gütersubventionen, die nicht bei der Berechnung des Produktionswerts berücksichtigt werden. Die Berechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Abschreibungen für Anlagevermögen oder die Ausbeutung und den Abbau natürlicher Ressourcen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Ausländische Direktinvestitionen pro Jahr
Erläuterung und Quellenangabe
Ausländische Direktinvestitionen umfassen die Geldflüsse für Direktinvestitionen im Inland. Dabei handelt es sich um die Summe aus Beteiligungskapital, Reinvestition von Erträgen und sonstigem Kapital.
Direktinvestitionen sind eine Form von grenzüberschreitenden Vermögensanlagen in Verbindung mit einem Anleger oder einer Anlegerin in einer Volkswirtschaft, der oder die Kontrolle oder ein bedeutendes Maß an Einfluss auf die Führung eines in einer anderen Volkswirtschaft ansässigen Unternehmens ausübt.
Eine Beteiligung von 10 Prozent oder mehr an den Stimmrechten ist das Kriterium für das Vorhandensein einer Direktinvestition. Die Angaben erfolgen in US-Dollar Nominalwert.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Export von Waren und Dienstleistungen
Erläuterung und Quellenangabe
Die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen umfasst den Wert aller ans Ausland gelieferten Waren und marktbestimmten Dienstleistungen. Inbegriffen sind der Kaufpreis der Ware, die Kosten für Fracht, Versicherung und Transport, Reisekosten, Lizenzgebühren und andere Dienstleistungen wie etwa im Bereich Kommunikation, Baugewerbe, Finanzen, Information sowie geschäftliche, persönliche und staatliche Dienstleistungen. Nicht berücksichtigt sind Arbeitnehmerentgelte und Einkünfte aus Kapitalvermögen (früher als Faktordienstleistungen bezeichnet) sowie Transferzahlungen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Import von Waren und Dienstleistungen
Erläuterung und Quellenangabe
Die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen umfasst den Wert aller aus dem Ausland gelieferten Waren und marktbestimmten Dienstleistungen. Inbegriffen sind der Kaufpreis der Ware, die Kosten für Fracht, Versicherung und Transport, Reisekosten, Lizenzgebühren und andere Dienstleistungen wie etwa im Bereich Kommunikation, Baugewerbe, Finanzen, Information sowie geschäftliche, persönliche und staatliche Dienstleistungen. Nicht berücksichtigt sind Arbeitnehmerentgelte und Einkünfte aus Kapitalvermögen (früher als Faktordienstleistungen bezeichnet) sowie Transferzahlungen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Wertschöpfung der Industrie (einschließlich Baugewerbe)
Erläuterung und Quellenangabe
Industrie (einschließlich Baugewerbe) umfasst gemäß der Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC, Abteilungen 05 bis 43) auch das verarbeitende Gewerbe (ISIC-Abteilungen 10 bis 33). Dazu gehört die Wertschöpfung im Bergbau, im verarbeitenden Gewerbe (auch als separate Untergruppe dargestellt), im Baugewerbe und bei der Erzeugung und Verteilung von Strom, Gas und Wasser.
Die Wertschöpfung ergibt sich aus dem Nettoproduktionswert eines Sektors nach Addition sämtlicher Produktionswerte und Subtraktion der Vorleistungen.
Die Berechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Abschreibungen für Anlagevermögen oder die Ausbeutung und den Abbau natürlicher Ressourcen.
Die Wertschöpfung wird durch die Internationale Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC), Revision 4 definiert. Anmerkung: Für Länder, die Kennzahlen für Statistiken mit Mehrwertdaten zu Herstellungspreisen erfassen („VAB“-Länder), wird bei der Bruttowertschöpfung von Faktorkosten ausgegangen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Wertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei
Erläuterung und Quellenangabe
Land- und Forstwirtschaft und Fischerei umfassen entsprechend der Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC, Abteilungen 1 bis 3) die Forstwirtschaft, die Jagd und die Fischerei sowie den Anbau von Feldfrüchten und die Tierhaltung.
Die Wertschöpfung ergibt sich aus dem Nettoproduktionswert eines Sektors nach Addition sämtlicher Produktionswerte und Subtraktion der Vorleistungen.
Die Berechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Abschreibungen für Anlagevermögen oder die Ausbeutung und den Abbau natürlicher Ressourcen.
Die Wertschöpfung wird durch die Internationale Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC), Revision 4 definiert. Anmerkung: Für Länder, die Kennzahlen für Statistiken mit Mehrwertdaten zu Herstellungspreisen erfassen („VAB“-Länder), wird bei der Bruttowertschöpfung von Faktorkosten ausgegangen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Wertschöpfung des Dienstleistungssektors
Erläuterung und Quellenangabe
Dienstleistungen umfassen entsprechend der Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC, Abteilungen 50 bis 99) die Wertschöpfung im Groß- und Einzelhandel (einschließlich Hotel- und Gaststättengewerbe), Verkehr und Transport, öffentliche und Finanzdienstleistungen, freiberufliche und persönliche Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung sowie Grundstücks- und Wohnungswesen.
Inbegriffen sind ebenfalls unterstellte Bankgebühren, Einfuhrabgaben und sämtliche von den zuständigen Stellen festgestellten und sich durch die Umskalierung ergebenden statistischen Abweichungen.
Die Wertschöpfung ergibt sich aus dem Nettoproduktionswert eines Sektors nach Addition sämtlicher Produktionswerte und Subtraktion der Vorleistungen.
Die Berechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Abschreibungen für Anlagevermögen oder die Ausbeutung und den Abbau natürlicher Ressourcen.
Die industrielle Wertschöpfung wird durch die Internationale Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC), Revision 3 oder 4 definiert.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Jährliche Inflation
Erläuterung und Quellenangabe
Die Inflation wird durch den Verbraucherpreisindex gemessen und gibt die jährliche prozentuale Änderung der Kosten für den Durchschnittsverbraucher beim Erwerb eines Sortiments von Waren und Dienstleistungen („Warenkorb“) an, der festgelegt oder in bestimmten Abständen wie beispielsweise jährlich angepasst werden kann. In der Regel wird dazu der Laspeyres-Index herangezogen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Beschäftigung
Anteil der Kinder, die arbeiten
Erläuterung und Quellenangabe
Kinder in Arbeitsverhältnissen sind Kinder zwischen 7 und 14 Jahren, die in der Berichtswoche der Erhebung zumindest eine Stunde lang eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt haben.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Arbeitslosenquote
Erläuterung und Quellenangabe
Die Erwerbslosigkeit (modellierte Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO) bezieht sich auf den Anteil der Erwerbsbevölkerung, der ohne Arbeit ist, aber dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und Arbeit sucht.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Erwerbstätigen in der Industrie an allen Erwerbstätigen
Erläuterung und Quellenangabe
Erwerbstätigkeit in der Industrie (modellierte Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO):
Erwerbstätige sind Personen im erwerbsfähigen Alter, die gegen Entgelt oder zur Erzielung eines Gewinns einer beruflichen Tätigkeit zur Produktion von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen nachgehen, unabhängig davon, ob sie während des Berichtszeitraums gearbeitet oder aufgrund einer befristeten Abwesenheit vom Arbeitsplatz oder Arbeitszeitregelung nicht gearbeitet haben.
Der Industriesektor umfasst gemäß der Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC) Abteilungen 2 bis 5 (ISIC 2) oder den Abschnitten C bis F (ISIC 3) oder den Abschnitten B bis F (ISIC 4) den Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden, das verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe und öffentliche Versorgungsunternehmen (Elektrizität, Gas und Wasser).
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft an allen Erwerbstätigen
Erläuterung und Quellenangabe
Erwerbstätigkeit in der Landwirtschaft (modellierte Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO):
Erwerbstätige sind Personen im erwerbsfähigen Alter, die gegen Entgelt oder zur Erzielung eines Gewinns einer beruflichen Tätigkeit zur Produktion von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen nachgehen, unabhängig davon, ob sie während des Berichtszeitraums gearbeitet oder aufgrund einer befristeten Abwesenheit vom Arbeitsplatz oder Arbeitszeitregelung nicht gearbeitet haben.
Der Agrarsektor umfasst gemäß der Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC) Abteilung 1 (ISIC 2) oder den Abschnitten A bis B (ISIC 3) oder dem Abschnitt A (ISIC 4) Tätigkeiten in der Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Fischerei.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Anteil der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor an allen Erwerbstätigen
Erläuterung und Quellenangabe
Erwerbstätigkeit im Dienstleistungssektor (modellierte ILO-Schätzung):
Erwerbstätige sind Personen im erwerbsfähigen Alter, die gegen Entgelt oder zur Erzielung eines Gewinns einer beruflichen Tätigkeit zur Produktion von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen nachgehen, unabhängig davon, ob sie während des Berichtszeitraums gearbeitet oder aufgrund einer befristeten Abwesenheit vom Arbeitsplatz oder Arbeitszeitregelung nicht gearbeitet haben.
Der Dienstleistungssektor umfasst gemäß der Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC) Abteilungen 6 bis 9 (ISIC 2) oder den Abschnitten G bis Q (ISIC 3) oder den Abschnitten G bis U (ISIC 4) Groß- und Einzelhandel, Restaurants und Hotels, Verkehr und Transport, Lagerei, Kommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen sowie Public-Relations- und Unternehmensberatung.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Verschuldung
Auslandsverschuldung gesamt
Erläuterung und Quellenangabe
Die Auslandsschulden insgesamt geben die finanziellen Verbindlichkeiten von Inländern gegenüber Ausländern an, die in Währung, Waren oder Dienstleistungen zurückzuzahlen sind.
Die Auslandsschulden umfassen die Summe der öffentlichen, öffentlich garantierten und privaten nicht garantierten langfristigen Schulden, die Inanspruchnahme von Krediten des Internationalen Währungsfonds (IWF) und kurzfristige Schulden.
Kurzfristige Schulden umfassen sämtliche Schulden mit einer ursprünglichen Laufzeit von einem Jahr oder weniger und Verzugszinsen für den Rückstand bei langfristigen Schulden. Die Angaben erfolgen in US-Dollar Nominalwert.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Auslandsschulden bei privaten Gläubigern
Erläuterung und Quellenangabe
Private nicht garantierte Auslandsschulden umfassen langfristige externe Verbindlichkeiten der privaten Schuldner, deren Rückzahlung nicht durch eine öffentliche Einrichtung garantiert wird. Die Angaben erfolgen in US-Dollar Nominalwert.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Schuldendienst gesamt
Erläuterung und Quellenangabe
Der Gesamtschuldendienst umfasst die Summe aus Kapitalrückzahlungen und Zinsen, die bei langfristigen Schulden tatsächlich in Form von Devisen, Waren oder Dienstleistungen gezahlt werden, sowie die Zinsen für kurzfristige Schulden und die Rückzahlungen (Rückkauf und Gebühren) an den Internationalen Währungsfonds (IWF).
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Schuldendienst für Auslandsschulden gesamt
Erläuterung und Quellenangabe
Der Gesamtschuldendienst für Auslandsschulden umfasst die Summe aus Kapitalrückzahlungen und Zinsen, die bei langfristigen Schulden tatsächlich in Form von Devisen, Waren oder Dienstleistungen gezahlt werden, sowie die Zinsen für kurzfristige Schulden und die Rückzahlungen (Rückkauf und Gebühren) an den Internationalen Währungsfonds (IWF).
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
Jährliche Inflation
Erläuterung und Quellenangabe
Die Inflation wird durch den Verbraucherpreisindex gemessen und gibt die jährliche prozentuale Änderung der Kosten für den Durchschnittsverbraucher beim Erwerb eines Sortiments von Waren und Dienstleistungen („Warenkorb“) an, der festgelegt oder in bestimmten Abständen wie beispielsweise jährlich angepasst werden kann. In der Regel wird dazu der Laspeyres-Index herangezogen.
Quelle: Globale Entwicklungsdaten der Weltbank (Externer Link)
SDG-Trends für Bosnien und Herzegowina
- Auf Kurs oder Bewahrung
- Leichte Verbesserung
- Stillstand
- Abnehmend
- Informationen nicht verfügbar