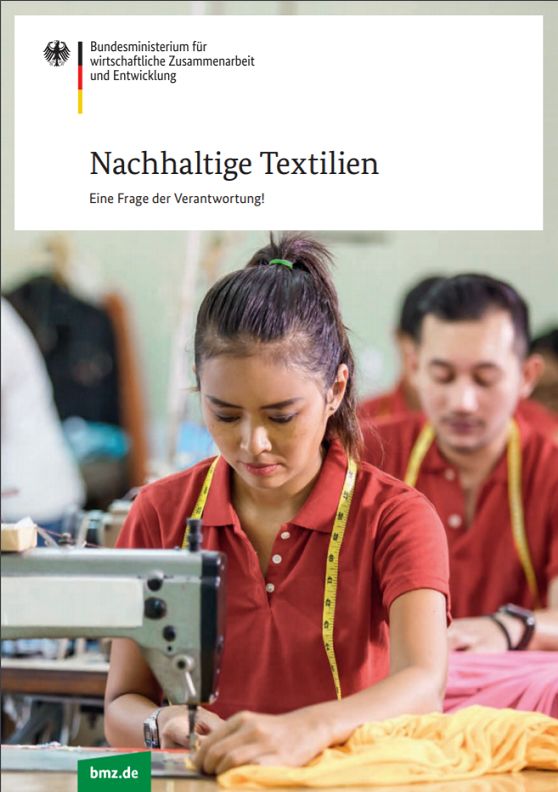Arbeiterinnen und Arbeiter in einer Textilfabrik in Bangladesch, in der besonders auf die Einhaltung der gesetzlichen Sozial- und Umweltstandards geachtet wird
Urheberrecht© Thomas Köhler/photothek
Umwelt- und Sozialstandards in der Textilwirtschaft verbessern
Die Produktion von Textilien ist in der Vergangenheit massiv gewachsen. Durch die schnell wechselnden Modetrends der „Fast Fashion“ hat sich der globale Konsum erhöht – mit negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.
Der Textilsektor wird für zwei bis zehn Prozent der Kohlendioxid-Emissionen, 20 Prozent der Frischwasserverschmutzung sowie für 16 bis 35 Prozent der Verunreinigungen der Meere durch Mikroplastik verantwortlich gemacht.
Neben ökologischen bestehen in der Textilwirtschaft auch viele soziale Herausforderungen. Die Gesundheit der Menschen in den Produktionsländern wird durch mangelnden Arbeitsschutz und unsachgemäße Nutzung und Entsorgung von Chemikalien gefährdet, beispielsweise beim Färben von Textilien.
Die Arbeitsbedingungen vor Ort sind oft sehr belastend, mit 16-Stunden-Arbeitstagen und Löhnen, die kaum oder gar nicht zum Leben reichen. Frauen, die den Großteil der Beschäftigten in der Textilproduktion ausmachen, sind besonders betroffen. Häufig werden ihnen grundlegende Rechte wie Mutterschutz, eine angemessene Gesundheitsversorgung und gewerkschaftliche Organisation vorenthalten.
Wir tragen Verantwortung
Durch unseren Konsum beeinflussen wir die Arbeitsbedingungen in den Ländern, in denen für uns produziert wird. Dadurch tragen wir Verantwortung. Wir können ihr gerecht werden, indem wir durch unsere Lieferketten faire soziale Standards setzen. Das ermöglicht den Menschen in den Produktionsländern ein selbstbestimmtes Leben und ein angemessenes Einkommen, was zu weniger Migration und meist mehr politischer Stabilität führt.
Auch im ökologischen Bereich können wir gezielt helfen, die mit unserem Konsum verbundenen Treibhausgasemissionen zu verringern, Frischwasserressourcen zu erhalten und die Nutzung gefährlicher Chemikalien zu reduzieren. Ziel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist es daher, gemeinsam mit den Partnerländern, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft die Umwelt- und Sozialstandards in der Textilwirtschaft zu verbessern.
Deutsches Engagement
Das Ziel ist klar: Wirtschaftswachstum soll Hand in Hand mit dem Schutz von Mensch und Natur gehen. Dafür sind menschenwürdige Arbeitsbedingungen einschließlich existenzsichernder Löhne, umweltschonende Produktionsmethoden und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft erforderlich.
Durch das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG (Externer Link)) sind Unternehmen in Deutschland dazu verpflichtet, in ihren Lieferketten Sorgfaltspflichten nachzukommen. Das bedeutet, sie müssen die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf Menschenrechte und Umwelt analysieren, Maßnahmen ergreifen, um Risiken vorzubeugen und Beschwerdemöglichkeiten für Betroffene einrichten.
Darüber hinaus setzt die deutsche Entwicklungspolitik einen starken Fokus auf die im Folgenden genannten Themen, die große Herausforderungen in der bestehenden Textillieferkette darstellen.
Unsere Instrumente
Um Umwelt- und Sozialstandards in der Textilwirtschaft durchzusetzen, nutzen wir verschiedene Instrumente, unter anderem die beiden BMZ-Initiativen „Grüner Knopf“ und „Bündnis für nachhaltige Textilien“. Diese bringen wichtige Akteure zusammen und setzen als Vorreiter Impulse für eine sozial gerechte Transformation globaler Textillieferketten.
Als Lizenznehmer des Grünen Knopfs und als Mitglieder des Bündnisses für nachhaltige Textilien engagieren sich Unternehmen für bessere Arbeitsbedingungen und Umweltschutz in der Textillieferkette.
Das vom BMZ 2014 gegründete Textilbündnis vereint Unternehmen, Verbände, Nichtregierungsorganisationen, Standardorganisationen, Gewerkschaften und die deutsche Bundesregierung. Die Bündnis-Mitglieder setzen sich gemeinsam für eine soziale, ökologische und korruptionsfreie Textil- und Bekleidungsbranche ein.
Das staatliche Siegel „Grüner Knopf“ kennzeichnet Textilien von verantwortungsvollen Unternehmen, die entlang ihrer Lieferkette ihren menschenrechtlichen und ökologischen Sorgfaltspflichten nachkommen. Zusätzlich bestätigen die Unternehmen durch anerkannte Siegel, dass die Produkte sozial und ökologisch hergestellt wurden. So können Verbraucherinnen und Verbraucher bewusstere und nachhaltigere Kaufentscheidungen treffen.
Unsere Partner
Wir arbeiten eng mit unseren Partnerländern und anderen Partnern wie Unternehmen, Zulieferern und Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sowie internationalen Organisationen zusammen, um die sozialen und ökologischen Bedingungen, für die Menschen, die in der Lieferkette arbeiten, zu verbessern.
Stand: 27.06.2024