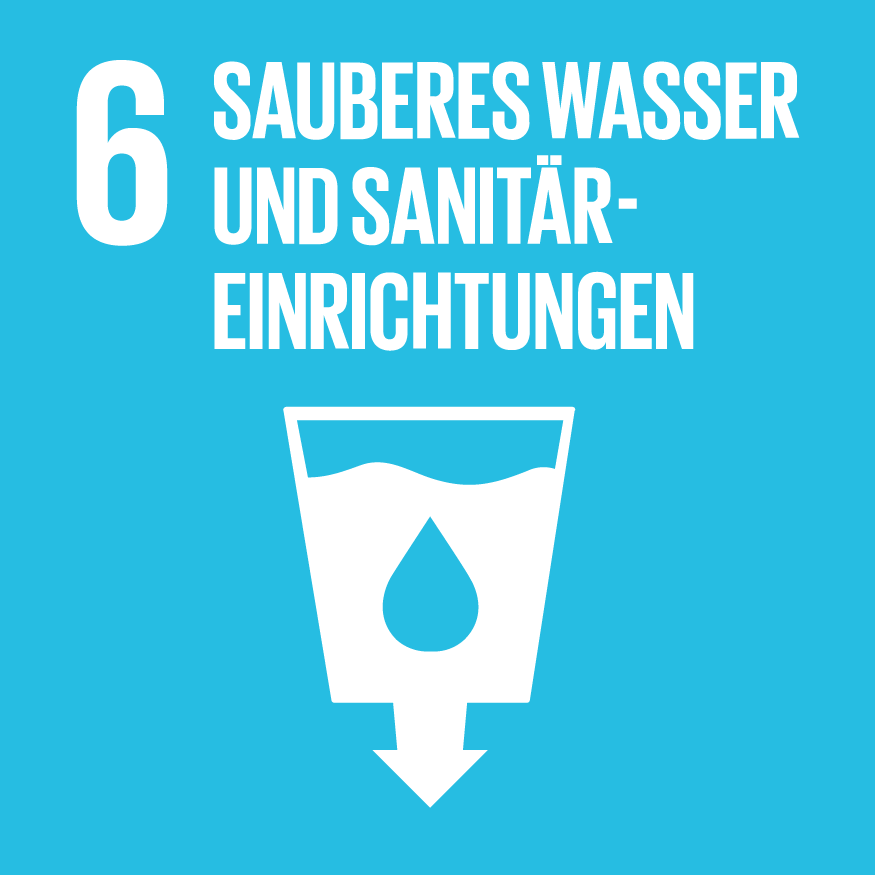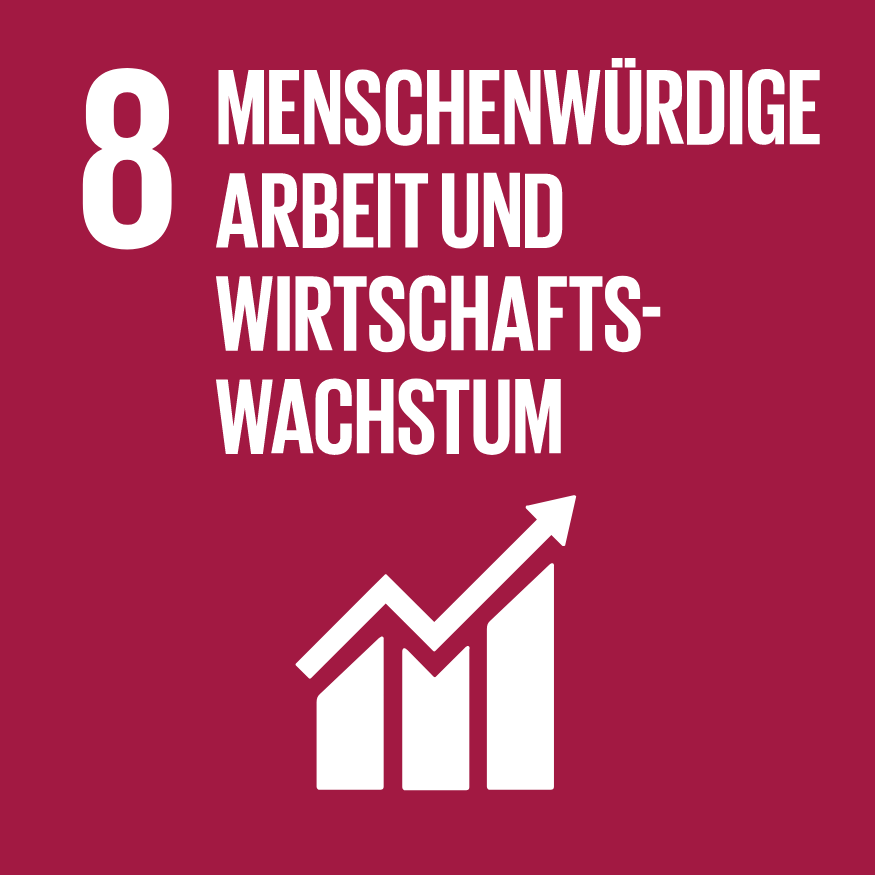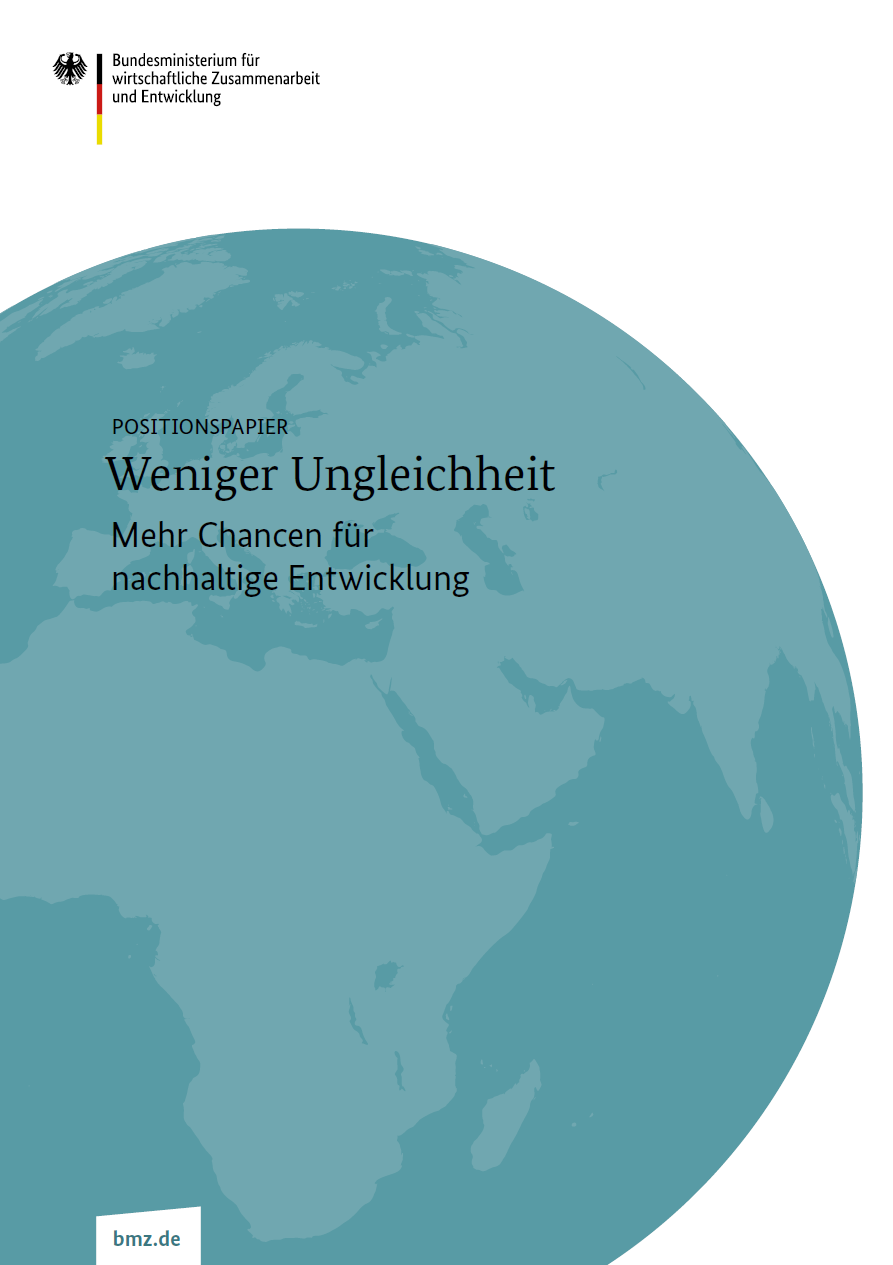Was wollen wir mit SDG 10 erreichen?
- Das Einkommen der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung soll bis 2030 stärker anwachsen als der jeweils nationale Durchschnitt
- Alle Menschen sollen – unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Herkunft oder sozialem und wirtschaftlichem Status – gleiche Möglichkeiten haben
- Abschaffung diskriminierender Gesetze und Politikmaßnahmen
- Ungleichheiten noch wirksamer verringern durch eine armutsorientierte Sozial-, Haushalts-, Steuer- und Lohnpolitik
- Mehr Mitsprache von Entwicklungsländern in internationalen Finanz- und Wirtschaftsorganisationen
- Geordnete, sichere, verantwortungsvolle und reguläre Migration und Mobilität
Zahlen und Fakten
76 %
des weltweiten Vermögens sind im Besitz der reichsten 10 % der Weltbevölkerung
Mehr als
123 Millionen
Menschen waren Ende 2024 weltweit auf der Flucht
Mehr als
8.100
flucht- oder migrationsbedingte Todesfälle wurden 2023 registriert – mehr als je zuvor und die Dunkelziffer liegt deutlich höher
2 %
des weltweiten Vermögens sind im Besitz der ärmsten Hälfte der Weltbevölkerung
8
Länder haben das SDG 10 bislang erreicht, der Großteil der Staaten steht noch vor erheblichen Herausforderungen
12,36 US-Dollar
mussten Migrantinnen und Migranten im Schnitt 2023 zahlen, um 200 US-Dollar in ihr Herkunftsland zu überweisen
SDG 10 Wo stehen wir?
In Bezug auf SDG 10 ist die Weltgemeinschaft nur bei etwa zehn Prozent der Zielvorgaben auf einem guten Weg. Bei mehr als 75 Prozent der gesetzten Ziele sind entweder keine oder zu wenig Fortschritte, bei mehr als 20 Prozent sogar rückläufige Entwicklungen zu verzeichnen. Um SDG 10 zu verwirklichen, braucht es verstärkte Anstrengungen, um Diskriminierung zu beenden und die Ursachen für Lohnunterschiede und den ungleichen Zugang zu Ressourcen zu bekämpfen.
Seit 2000 konnten zwei Drittel der Länder den Anteil ihrer Bevölkerung senken, der von weniger als der Hälfte des mittleren Einkommens lebt. Weltweit lag dieser Anteil zuletzt bei 12,1 Prozent. Allerdings sind in diese Auswertung der Vereinten Nationen nur Daten aus 82 Ländern eingeflossen, rund 30 Prozent der Weltbevölkerung bleiben unberücksichtigt. Die höchste Einkommensungleichheit herrscht in den Ländern Lateinamerikas und der Karibik.
Die Löhne der Beschäftigten sind nicht im gleichen Maße gestiegen wie die Produktivität. Die Lohnquote – also der Anteil der Arbeitsentgelte am Bruttoinlandsprodukt – setzt ihre langjährige Talfahrt fort. Das trifft vor allem ärmere und benachteiligte Beschäftigte, die von ihren Arbeitseinkünften abhängig sind. Wohlhabende Menschen haben dagegen von steigenden Kapitalerträgen auf Vermögen profitiert, was die Ungleichheit innerhalb der Gesellschaften verschärft.
Jedes dritte der 75 verwundbarsten Länder – definiert als die Länder, die zinsvergünstigte Darlehen der Internationalen Einwicklungsorganisation (IDA) (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) erhalten können – ist heute ärmer als vor der Corona-Pandemie. Die Hälfte der „IDA-Länder“ ist überschuldet oder überschuldungsgefährdet. Ebenfalls in jedem zweiten Land aus dieser Gruppe ist in den vergangenen fünf Jahren das Pro-Kopf-Einkommen langsamer gewachsen als in den hoch entwickelten Volkswirtschaften. Jeder vierte Mensch in diesen Ländern muss täglich mit umgerechnet weniger als 2,15 US-Dollar auskommen. In den verwundbarsten Ländern leben etwa 25 Prozent der Weltbevölkerung und 90 Prozent der von Hunger und Fehlernährung betroffenen Menschen.
Auch der Klimawandel und gewaltsame Konflikte sind wichtige Treiber von Ungleichheit, die sich gegenseitig verstärken. Die Zahl der Menschen, die vor Verfolgung, Konflikten, Menschenrechtsverletzungen oder Katastrophen fliehen mussten, ist auf einen Rekordwert gestiegen: Ende 2024 war einer von 67 Menschen weltweit auf der Flucht – das ist der höchste jemals dokumentierte Wert.
48 Prozent der Weltbevölkerung verfügen über keinerlei soziale Absicherung.
SDG-10-Quiz Was denken Sie?
Die Ungleichheit ist während der Covid-19-Pandemie weiter angestiegen.
SDG 10 Was müssen wir tun?
Eine hohe Ungleichheit hemmt die Entwicklungschancen und die Verwirklichung der Menschenrechte. Sie gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Funktionsfähigkeit von Demokratien und kann so zu sozialen Unruhen, politischer Instabilität und gewaltsamen Konflikten führen. Die Reduzierung von Ungleichheit stellt daher eine der zentralen Zukunftsaufgaben der Menschheit dar.
Verschiedene Studien zeigen: Wirtschaftswachstum allein führt nicht zwangsläufig zu weniger Ungleichheit. Entscheidend ist, dass Wachstum inklusiv gestaltet wird und große Ungleichheiten durch eine angepasste Steuer- und Haushaltspolitik ausgeglichen werden.
Staatliche Einnahmen sollten dafür genutzt werden, allen Menschen Zugang zu Basisdienstleistungen wie Bildung und Gesundheit sowie zu sozialen Sicherungssystemen zu ermöglichen. Korruption, Steuervermeidung und die politische und soziale Ausgrenzung von benachteiligten Personen und Gruppen müssen konsequent bekämpft werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und Ungleichheiten dauerhaft zu verringern.
Um die Ungleichheit zwischen den Staaten zu beseitigen, braucht es eine gerechte Ressourcenverteilung, Investitionen in schulische und berufliche Bildung sowie eine internationale Zusammenarbeit für den Aufbau fairer Handels- und Finanzsysteme. Dazu muss die Mitwirkung der Entwicklungsländer an internationalen wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen gestärkt werden. In den entsprechenden Gremien und Organisationen der Vereinten Nationen sind sie deutlich unterrepräsentiert.
SDG 10 Das deutsche Engagement für SDG 10
Das BMZ unterstützt Partnerländer dabei, ihre öffentlichen Finanzsysteme transparent und fair auszugestalten, menschenwürdige Beschäftigung zu fördern, einen gerechten Zugang zu Bildung, Gesundheit, Wasser und Nahrung zu gewährleisten, soziale Sicherungssysteme auf- und auszubauen und die politische Teilhabe aller Menschen sicherzustellen.
Ein weiterer Fokus liegt darauf, in Armut lebende Menschen gegen die Folgen des Klimawandels zu schützen und Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen sozialverträglich zu gestalten.
Außerdem stärkt das BMZ die Potenziale regulärer Migration für die Entwicklung in den Partnerländern.
Stand: 03.02.2025