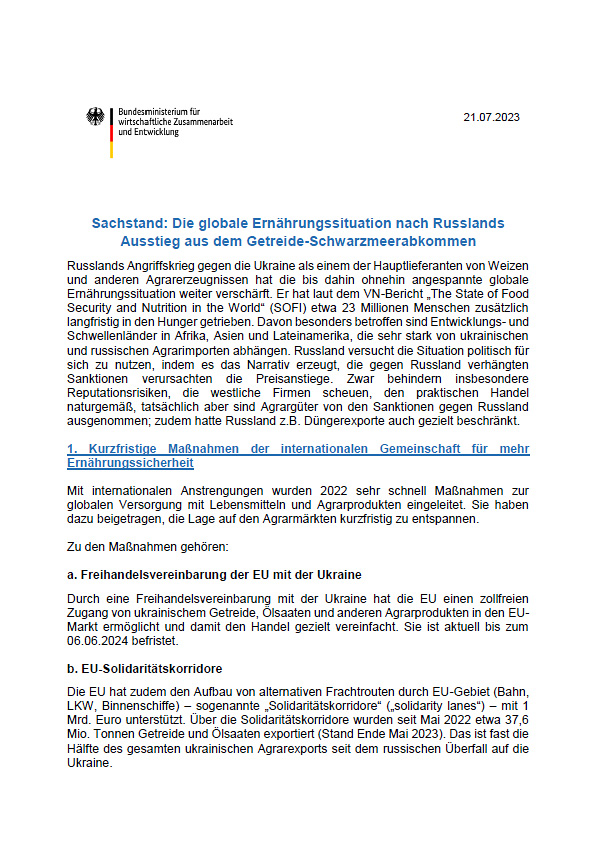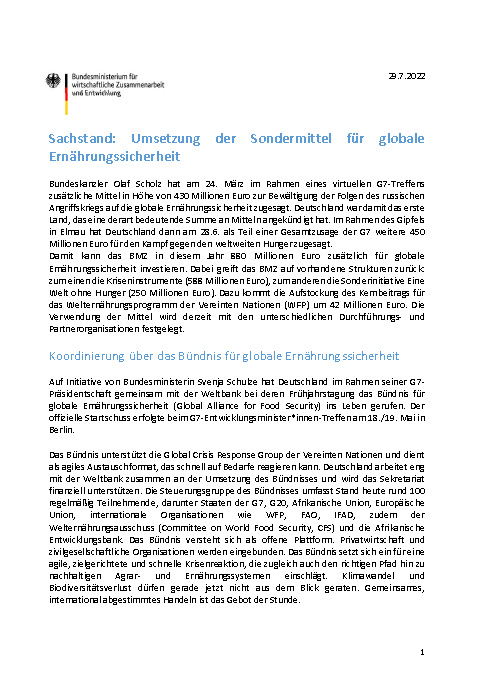Sonderinitiative Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme
Zudem werden mehr Investitionen in Bildung und Ausbildung, in Infrastruktur und in Wertschöpfung vor Ort gebraucht.
Erforderlich ist außerdem mehr Geschlechtergerechtigkeit – denn Frauen sind entscheidend für die Ernährungssicherheit, werden aber noch zu oft daran gehindert, ihre Potenziale zu nutzen. Hätten Frauen den gleichen Zugang zu Produktionsressourcen wie Männer, könnten sie ihre Erträge deutlich steigern und weniger Menschen müssten an Hunger leiden.
Unser Engagement
Mit der neu ausgerichteten Sonderinitiative „Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme – faire Einkommen, gesunde Ernährung, intakte Umwelt“ trägt die deutsche Entwicklungspolitik dazu bei, Hunger und Mangelernährung zu bekämpfen.
Im Rahmen des BMZ-Kernthemas „Leben ohne Hunger“ ist die Initiative ein wichtiges Instrument, um schnell und effektiv Wirkung zu erzielen und das Recht aller Menschen auf gesunde Nahrung durchzusetzen.
Die Sonderinitiative stärkt die drei Aktionsfelder der deutschen Entwicklungszusammenarbeit Ernährungssicherung, ländliche Entwicklung und Landwirtschaft. Dabei setzt sie zukünftig neue Akzente durch:
- Beiträge zu einer globalen Strukturpolitik auf multilateraler und internationaler Ebene,
- Förderung der Geschlechtergerechtigkeit,
- Entwicklung und Erprobung innovativer Ansätze sowie Förderung von praxisnaher Forschung und
- Integration der Sonderinitiative in die laufende Zusammenarbeit mit den Partnerländern – um den Aufbau von nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystemen noch besser zu fördern.
Während der deutschen G7 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)-Präsidentschaft 2022 bekräftigten die G7-Staaten ihr Ziel, bis 2030 500 Millionen Menschen von Hunger und Mangelernährung zu befreien. Auch um dieses Ziel erreichen zu können, ist die langfristige Transformation von Landwirtschafts- und Ernährungssystemen in Entwicklungsländern – hin zu mehr Resilienz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit – erforderlich.
Zahlen und Fakten
Seit 1990 wurden große Erfolge bei der weltweiten Hungerbekämpfung erzielt. Doch seit einigen Jahren steigt die Zahl der Hungernden wieder.
- 2024 hungerten rund 673 Millionen Menschen – knapp jeder zwölfte Mensch weltweit, auf dem afrikanischen Kontinent sogar jeder Fünfte.
- Weltweit kann sich fast jeder dritte Mensch keine gesunde Ernährung leisten. Drei von vier Menschen, die sich keine gesunde Ernährung leisten können, leben in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen.
- 1/3 der Frauen und 2/3 der Kinder im Alter von unter zwei Jahren nehmen weniger Vitamine und Mineralstoffe zu sich als für eine gute Ernährung und Gesundheit erforderlich wären.
- Hunger und alle Formen der Fehlernährung bis 2030 zu beenden, bleibt eine gewaltige Herausforderung: Schätzungen gehen davon aus, dass im Jahr 2030 immer noch 512 Millionen Menschen von Hunger betroffen sein könnten.
- Haupttreiber von Hunger sind gewalttätige Konflikte, der Klimawandel und wirtschaftliche Schocks.
Im Detail Die BMZ-Sonderinitiative „Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“
Grafik: Schwerpunktländer und weitere Projektstandorte der Sonderinitiative „Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt mit der Sonderinitiative „Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“ langfristige Ernährungssicherheit und das Menschenrecht auf Nahrung. Gefördert werden unter anderem Mütter- und Kinderernährung Schulernährungsprogramme, nachhaltige Landnutzung, gerechte Wertschöpfungsketten sowie eine klimaangepasste und nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei und Aquakultur.
Neben der direkten Reaktion auf akute Krisen ist es ein Kernanliegen der deutschen Entwicklungspolitik, Agrar- und Ernährungssysteme, inkl. Fischerei und Aquakultur, langfristig resilienter und nachhaltiger zu machen.
Dafür investierte das BMZ 2024 rund 2,4 Milliarden Euro.
Mit strategischen Partnerschaften wird das deutsche Engagement gezielt verstärkt und international wirksam gemacht – vor allem in Zeiten sinkender Mittelansätze.
Fragen und Antworten zur Sonderinitiative
Wie wollen wir die Agrarpolitik der Zukunft gestalten?
Um den Hunger zu beenden und weil die Weltbevölkerung wächst, muss die globale Nahrungsmittelproduktion bis 2050 um etwa 60 Prozent steigen – auf den vorhandenen Flächen, mit den vorhandenen Wasserressourcen. Dazu ist schnellstmöglich eine umfassende Anpassung der bisherigen Landwirtschaft erforderlich: Sie muss nachhaltiger und ressourcenschonender werden. Unter anderem soll dies erreicht werden durch besseres Saatgut, zielgenaue Bewässerung, einen an die lokalen Verhältnisse angepassten Einsatz von Maschinen und durch die Vermeidung von Verlusten nach der Ernte, die zum Beispiel bei Transport und Lagerung der Nahrungsmittel entstehen können. Außerdem muss die Landwirtschaft der Zukunft die Biodiversität bewahren und Abholzungen verhindern.
Warum sind Kleinbäuerinnen und -bauern Zielgruppe der Sonderinitiative?
Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist die vorherrschende Bewirtschaftungsform in Entwicklungsländern und liefert dort den Großteil der benötigten Nahrungsmittel. Wenn arme Kleinbauernfamilien mehr ernten und mehr verkaufen, so hilft das nicht nur ihnen selbst, sondern es kommen insgesamt mehr und bezahlbare Nahrungsmittel auf den Markt – ein Schritt zu mehr Ernährungssicherheit auf dem Land und in den Städten. Die Sonderinitiative fördert besonders Frauen, da sie eine Schlüsselrolle bei der Ernährungssicherung spielen.
Wie hat die Sonderinitiative auf die Coronakrise reagiert?
Die Programme der Sonderinitiative „Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“ sollen Kleinbäuerinnen und -bauern langfristig widerstandsfähig (resilient) gegen verschiedene Arten von Krisen machen. Um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern, hat das BMZ kurzfristig zusätzliche Aktivitäten gestartet. Unter anderem wurden Lebensmittel, Saatgut und Dünger bereitgestellt. Maßnahmen, die Nachernteverluste vermeiden sollen und zu mehr Vielfalt im Anbau beitragen, werden aktuell ausgeweitet, um Kleinbauernfamilien während der Pandemie zu stärken. Um den Gesundheitsschutz zu verbessern, wurden Aufklärungsprogramme gestartet und bei Schulungen werden Schutzmasken verteilt.
Wie hat die Sonderinitiative auf den Ukraine-Krieg reagiert?
Für Maßnahmen der Sonderinitiative standen 2022, über das bisherige Budget hinaus, zusätzlich 525 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist, die landwirtschaftliche Produktion zu sichern, den Agrarhandel aufrechtzuerhalten und die Armuts- und Hungerrisiken zu reduzieren.
Die Maßnahmen konzentrieren sich vor allem auf Afrika, den Nahen Osten und Länder, die von den aktuellen Preissteigerungen für Nahrungsmittel besonders betroffen sind.
Warum ist Hungerbekämpfung auch Friedenspolitik?
Armut, Konflikte und der Klimawandel gehören zu den Hauptursachen von Hunger (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Gleichzeitig führen Hunger oder eine unsichere Ernährungslage zu neuer Armut und können Unruhen und Konflikte auslösen oder verstärken. Investitionen in ländliche Entwicklung und Ernährungssicherung tragen entscheidend dazu bei, diesen sich selbst verstärkenden Kreislauf zu unterbrechen. Die Sonderinitiative „Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“ leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur Friedenssicherung und zur Bekämpfung von Fluchtursachen.
Mit wem arbeitet das BMZ zusammen?
Intensive Kooperation ist ein Leitprinzip der Sonderinitiative: Das BMZ arbeitet mit Partnern aus Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kirchen sowie den Durchführungsorganisationen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) GIZ und KfW zusammen.
Wichtige Partner in Afrika sind dabei das pan-afrikanische Netzwerk zur Agrarförderung der Afrikanischen Union (Comprehensive Africa Agriculture Development Programme, CAADP) und die Einrichtungen der internationalen Agrarforschung.
Stand: 04.12.2025