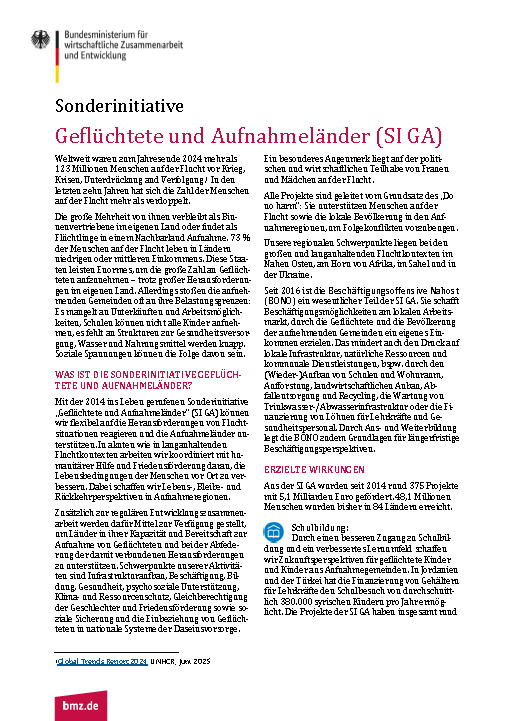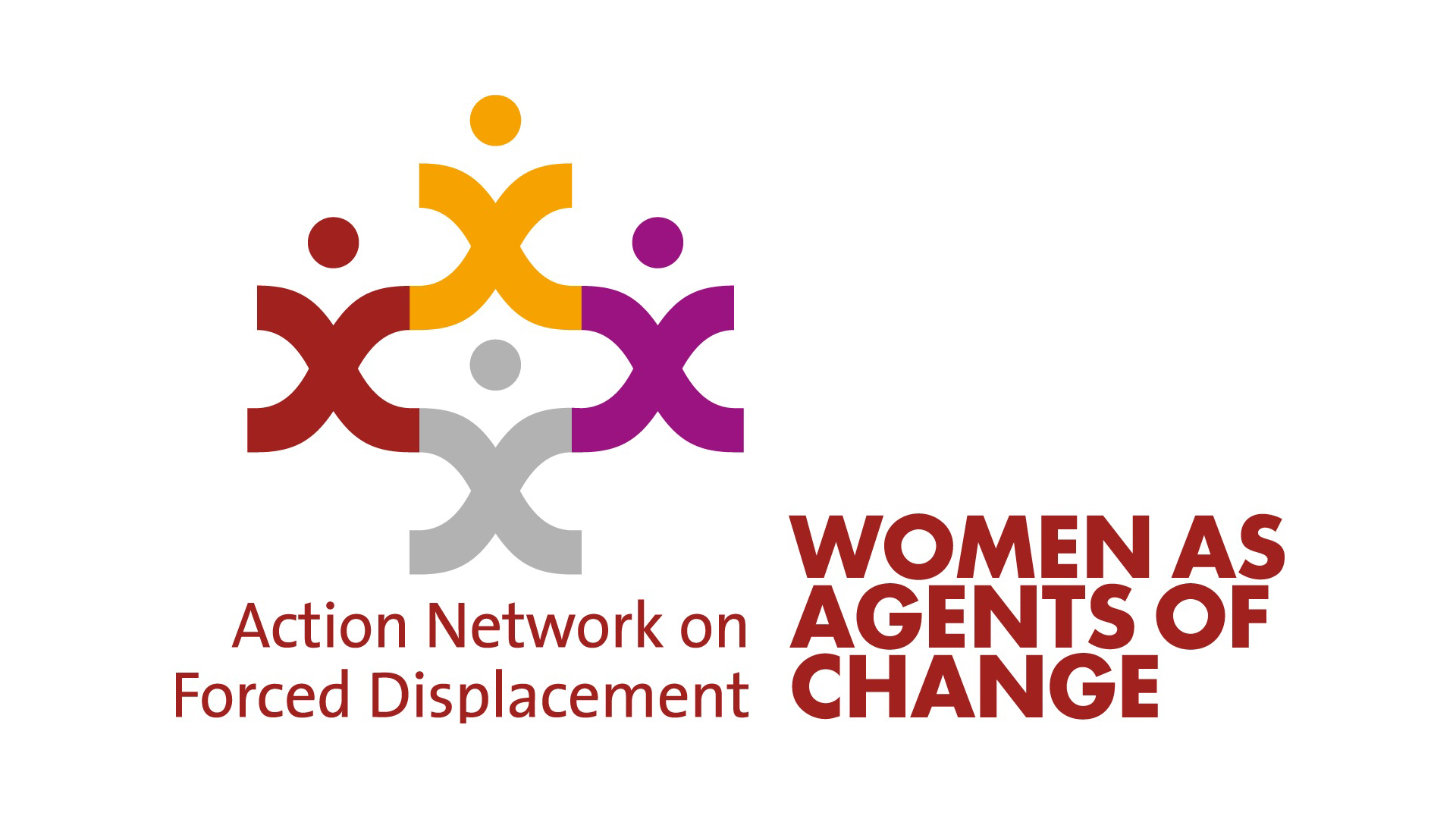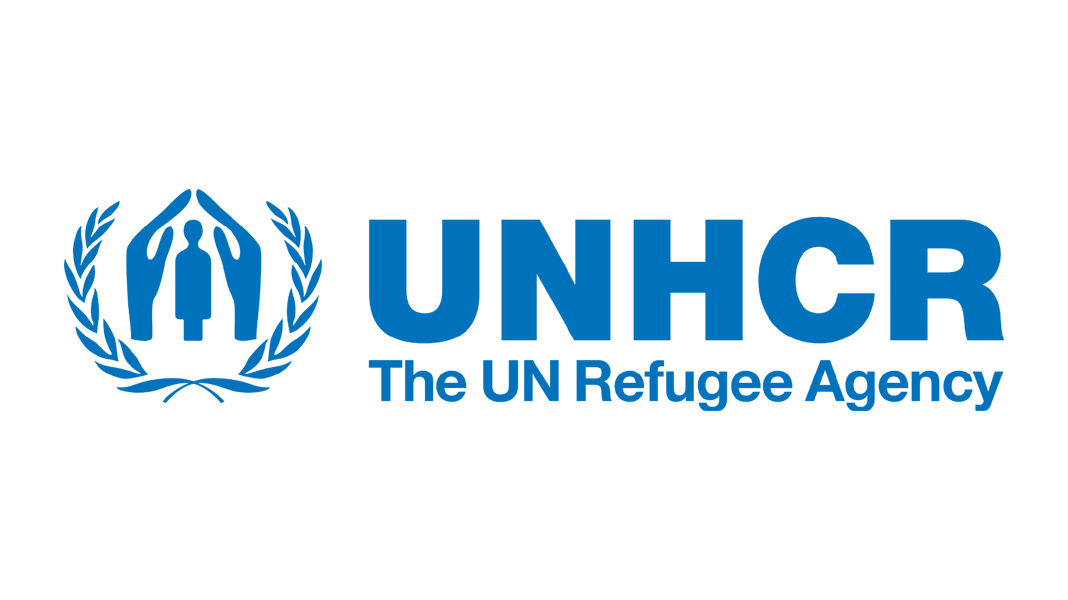Das UNHCR-Camp für syrische Flüchtlinge in der Autonomen Region Kurdistan im Irak, Aufnahme von 2014
Urheberrecht© Michael Gottschalk/photothek.net
Menschen auf der Flucht
In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Vertriebenen fast verdoppelt. Und ein Ende dieser dramatischen Situation ist zurzeit nicht absehbar. Weltweit erleiden Millionen Kinder und Erwachsene eine humanitäre Katastrophe.
Die größte aktuelle Vertreibungskrise wurde durch den Krieg in Sudan ausgelöst: Ende 2024 waren 14,3 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen auf der Flucht – fast ein Drittel der Bevölkerung. Hohe Vertreibungszahlen wurden weiterhin für Syrien, Venezuela, Afghanistan, die Demokratische Republik Kongo und die Ukraine verzeichnet.
Die Unterstützung von Geflüchteten und Aufnahmeländern hat für die deutsche Entwicklungspolitik höchste Priorität. Niemand flüchtet freiwillig und die meisten Geflüchteten wünschen sich nichts mehr, als in ihre Heimat zurückkehren zu können. Sie alle verdienen Schutz und die volle Solidarität der Weltgemeinschaft.
Deutschland unterstützt mit seiner Entwicklungszusammenarbeit Länder, die besonders viele Geflüchtete aufnehmen, obwohl sie selbst sehr arm sind. Denn die allermeisten Menschen auf der Flucht bleiben in der Nähe ihrer Heimat: Fast 60 Prozent der Geflüchteten lebten Ende 2024 als Binnenvertriebene im eigenen Land. Rund 70 Prozent der über eine Grenze Geflüchteten blieben in Nachbarstaaten ihrer Heimat. Fast drei Viertel der Vertriebenen wurden von Ländern mit nur geringem oder mittlerem Einkommen aufgenommen.
Arbeitsschwerpunkte
In akuten Not- und Krisenlagen sichert die humanitäre Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft das Überleben der Menschen auf der Flucht. Für diese Soforthilfe ist innerhalb der Bundesregierung das Auswärtige Amt verantwortlich.
Die Entwicklungszusammenarbeit unterstützt hingegen mittel- und langfristig. Das BMZ stimmt sich deshalb bei seinem Engagement in Krisenregionen eng mit dem Auswärtigen Amt ab, um die humanitäre Hilfe optimal mit den Vorhaben der langfristig wirkenden und strukturbildenden Entwicklungszusammenarbeit zu verknüpfen.
Aufgabe und Ziel des BMZ ist es, Menschen in Entwicklungsländern darin zu unterstützen, ein Leben in Sicherheit und Würde zu führen und Perspektiven für sich und ihre Kinder zu entwickeln. Dafür engagiert sich das Ministerium auf vielfältige Weise.
Initiativen und Programme
Ein großer Teil der Mittel des BMZ wird für die klassische bilaterale, multilaterale und nichtstaatliche Entwicklungszusammenarbeit verwendet.
Aber auch die Übergangshilfe, die in fragilen und von akuten oder langanhaltenden Krisen betroffenen Staaten die Widerstandsfähigkeit von Menschen und Gesellschaften stärkt, ist ein wichtiges Instrument des BMZ im Bereich Flucht und Migration.
Das BMZ hat seit 2014 zudem spezifische Sonderinitiativen geschaffen, die die klassische Entwicklungszusammenarbeit ergänzen.
Um Perspektiven für die Menschen in den Krisengebieten und Aufnahmeländern zu schaffen, wurden außerdem verschiedene Programme gestartet.
BMZ-Sonderinitiative Geflüchtete und Aufnahmeländer
Mit dieser Sonderinitiative kann das BMZ gezielt auf die Herausforderungen reagieren, die durch die weltweiten Fluchtbewegungen entstehen. Seit 2014 wurden durch die Sonderinitiative mehr als 375 Projekte in 84 Ländern durchgeführt, rund 48,1 Millionen Menschen konnten damit bereits unterstützt werden (Stand: Juni 2025).
Das BMZ setzt in seiner Arbeit auf einen verstärkten Dialog mit Aufnahmeländern über den Schutz, die Versorgung und Integration von Geflüchteten. Ziel ist es, den von Flucht und Vertreibung betroffenen Menschen ein Leben in Sicherheit und Würde zu ermöglichen und auch die Menschen in den betroffenen Aufnahmegemeinden zu unterstützen. Auch Binnenvertriebene werden mit ihren spezifischen Rahmenbedingungen und Herausforderungen durch die Initiative gezielt unterstützt.
Die Maßnahmen sind breit gefächert und umfassen unter anderem die Bereiche Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, soziale Sicherung oder psychosoziale Unterstützung. Maßnahmen mit Klima- und Energiebezug werden vermehrt gefördert, zum Beispiel Projekte zur Aufforstung, zum Erosionsschutz oder die Beratung von Regierungen bei der Unterstützung von Menschen, die aufgrund des Klimawandels fliehen müssen. Lokale zivilgesellschaftliche Organisationen und Kommunen werden in die Planung und Durchführung der Maßnahmen einbezogen.
Ein Schwerpunkt der Initiative liegt auf der Stärkung von Frauen. Bisher konnten zum Beispiel mit Cash-for-Work-Maßnahmen sehr gute Beschäftigungsquoten für Frauen erzielt werden. Die Sonderinitiative wird ihre gendertransformativen Wirkungen ausbauen, indem sie zunehmend gender-relevante Machtstrukturen und Prozesse adressieren wird, zum Beispiel dadurch, dass Frauen stärker in politische Prozesse eingebunden werden oder ihre rechtliche Situation in ihrem Land verbessert wird.
Regionale Schwerpunkte
Die Arbeit des BMZ im Bereich Flucht konzentriert sich zurzeit vor allem auf Länder im Nahen Osten, in denen besonders viele Menschen auf der Flucht sind und die dadurch an die Grenzen ihrer Versorgungskapazitäten geraten sind, sowie auf afrikanische Länder, die viele Flüchtlinge und Binnenvertriebene aufgenommen haben oder aus denen viele Flüchtlinge kommen. Auch die Ukraine ist eine Schwerpunktregion.
Deutschland engagiert sich außerdem in Ländern in anderen Weltregionen, die besonders viele Geflüchtete aufgenommen haben, etwa Pakistan und Kolumbien.
Internationale Zusammenarbeit
Die Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung für Flüchtlinge (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), Binnenvertriebene (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und aufnehmende Gemeinden sind Teil des internationalen Engagements.
Dabei arbeitet Deutschland eng mit internationalen Organisationen zusammen: mit den Vereinten Nationen und ihrem Kinderhilfswerk (UNICEF), ihrem Welternährungsprogramm (WFP) sowie ihrem Entwicklungsprogramm (UNDP), mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM). Gemeinsam mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) bemüht sich Deutschland um eine bessere Verzahnung von humanitärer Hilfe und langfristig orientierter Entwicklungszusammenarbeit.
Die Bundesregierung kooperiert zudem auch mit Organisationen der deutschen Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Das BMZ unterstützt die Arbeit dieser Organisationen mit erheblichen finanziellen Beiträgen, die in akuten Krisen jeweils aufgestockt werden.
Um eine gerechtere Verteilung der Verantwortung innerhalb der internationalen Gemeinschaft zu erreichen, haben die Vereinten Nationen im Dezember 2018 den Globalen Flüchtlingspakt (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) verabschiedet.
Vom 13. bis 15. Dezember 2023 fand das zweite Globale Flüchtlingsforum zur Umsetzung des Globalen Flüchtlingspakts in Genf statt. Regierungen, der Privatsektor, Nichtregierungsorganisationen und andere machten dabei finanzielle Zusagen in Höhe von insgesamt über 2,2 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus haben sie sich verpflichtet, Flüchtlinge und Aufnahmegemeinschaften in ihrer Politik, ihren Finanzierungsinstrumenten und Programmen zu berücksichtigen. Deutschland kam hier als einem der größten Aufnahme- und Geberländer eine besondere Rolle zu.
Stand: 17.07.2025