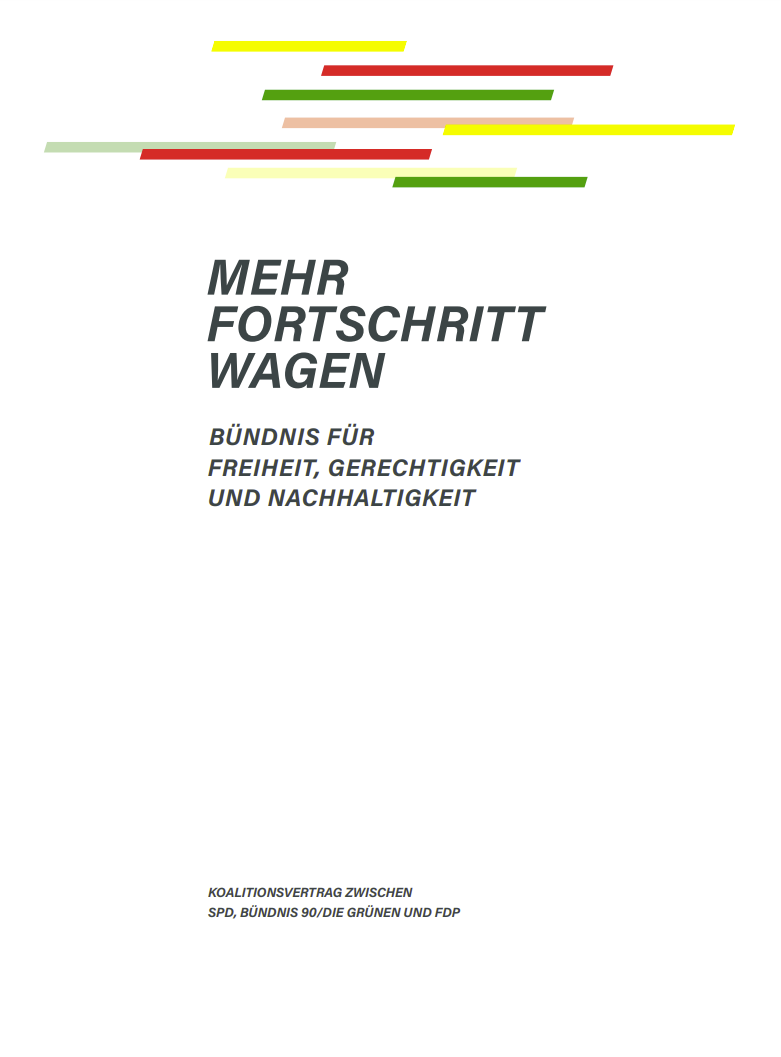Hintergrundinformationen Lieferketten und Lieferkettengesetz
Im Juni 2011 haben die Vereinten Nationen Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (Externer Link) verabschiedet. Sie sollen die Verletzung von Menschenrechten durch Wirtschaftsunternehmen verhindern und definieren die staatliche Schutzpflicht und die unternehmerische Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte in globalen Lieferketten.
Um diese Leitprinzipien in Deutschland umzusetzen, hat die Bundesregierung zunächst auf freiwilliges Engagement gesetzt. Im Dezember 2016 hat sie den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (Externer Link) (NAP) verabschiedet und einen Überprüfungsmechanismus eingerichtet.
Das Ergebnis: Zu wenige Unternehmen erfüllen ihre menschenrechtliche Sorgfaltspflicht.
Unternehmensbefragung
Bei einer ersten Unternehmensbefragung 2019 füllten nur 400 von mehr als 3.000 angeschriebenen Unternehmen den Fragebogen aus. Die Auswertung ergab, dass nur 20 Prozent dieser 400 Unternehmen die Anforderungen des NAP erfüllten. An einer zweiten Unternehmensbefragung im Jahr 2020 beteiligten sich 450 von 2.250 kontaktierten Unternehmen und nur 17 Prozent von diesen erfüllten die Anforderungen.
Der NAP sieht vor, dass die Bundesregierung weitere Schritte bis hin zu gesetzlichen Maßnahmen prüfen wird, wenn weniger als 50 Prozent der Unternehmen ihre menschenrechtliche Sorgfaltspflicht erfüllen.
Mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz setzt die Bundesregierung die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen verbindlich um.
Wir unterstützen ein wirksames EU-Lieferkettengesetz, basierend auf den UN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte, das kleinere und mittlere Unternehmen nicht überfordert. (…) Wir unterstützen den Vorschlag der EU-Kommission zum Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten. Wir unterstützen das von der EU vorgeschlagene Importverbot von Produkten aus Zwangsarbeit.
Unser Ziel Faire und nachhaltige Lieferketten in Europa und weltweit
Das Ziel bleibt eine einheitliche europäische Regelung für nachhaltige Lieferketten. So werden gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen und internationale Standards gesetzt. Ein verbindlicher rechtlicher Rahmen in Europa wird die Verantwortung von Unternehmen für die Achtung von Menschenrechten und Umweltstandards stärken und die Lebenssituation der Betroffen verbessern.
Faire Lieferketten in Europa
Viele Unternehmen verlangen selbst nach einem verbindlichen Rechtsrahmen für unternehmerische Sorgfaltspflichten. Neben Deutschland hat auch Frankreich bereits einen solchen Rahmen; in vielen weiteren EU-Ländern sind ähnliche Vorhaben geplant oder die Gesetzgebungsprozesse initiiert.
Im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 hat die Bundesregierung die Initiative von EU-Justizkommissar Didier Reynders für eine verbindliche Regelung unternehmerischer Sorgfaltspflichten auf EU-Ebene und eine EU-Regulierung für entwaldungsfreie Lieferketten unterstützt.
Als größter gemeinsamer Wirtschaftsraum der Welt muss die EU bei fairen Lieferketten vorangehen und Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in ihren Lieferketten beenden. EU-weite Regelungen können Rechtsklarheit, Rechtssicherheit, Transparenz und Wettbewerbsgleichheit für alle Unternehmen schaffen und zugleich helfen, eventuelle Missstände vor Ort zu beseitigen.
Vor diesem Hintergrund hat die EU-Kommission Anfang 2022 ihren Richtlinienentwurf zur Regelung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten in globalen Lieferketten vorgestellt. Auf EU-Ebene wird in Kürze eine Regelung zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Kraft treten (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Nach einer intensiven Diskussion hat die Mehrheit der EU-Staaten im März 2024 für dieses europäische Lieferkettengesetz gestimmt. Am 24. April 2024 hat das Europaparlament die EU-Lieferkettenrichtlinie verabschiedet. Als letzter Schritt hat der EU-Ministerrat der Richtlinie am 24. Mai 2024 formell zugestimmt. Die Richtlinie muss nun bis 2026 in nationales Recht umgesetzt werden.
Die EU setzt damit einen gesetzlichen Rahmen für alle Großunternehmen, die auf dem Binnenmarkt tätig sind – europäische sowie außereuropäische Unternehmen.
Fairer Handel als Grundprinzip einer neuen WTO
Die Welthandelsorganisation (WTO) muss zu einer Fairhandelsorganisation weiterentwickelt werden. Bereits das Gründungsdokument – der Vertrag von Marrakesch – betont das Ziel nachhaltiger Entwicklung und den Schutz und die Erhaltung der Umwelt. Dieser Dreiklang fehlt jedoch im Welthandel bis heute. Selbst wenn Unternehmen die Umwelt zerstören oder ausbeuterische Kinderarbeit Teil der Produktion sind, werden sie handelsrechtlich behandelt wie jene, die alle Öko- und Sozialstandards einhalten.
Dies muss sich dringend ändern. Wer beispielsweise gegen internationale Standards, wie die ILO-Kernarbeitsnormen (Externer Link), das Pariser Klimaschutzabkommen (Externer Link) oder aber die Konvention zum Schutz der Biodiversität (Externer Link) verstößt, muss seinen Anspruch auf Gleichbehandlung verlieren.
Die Nichtbeachtung internationaler Standards muss zu Nachteilen im EU-Binnenmarkt führen dürfen. Gleichzeitig wird die Bundesrepublik Deutschland ihr Angebot auf Unterstützung bei der Einhaltung entsprechender Standards in Entwicklungs- und Schwellenländern weiter erhöhen.
Gründe für ein Lieferkettengesetz
Trotz international verbindlicher Vorgaben hat die deutsche Bundesregierung lange auf das freiwillige Engagement der Unternehmen gesetzt. Doch die Ergebnisse des NAP-Monitorings waren ernüchternd: Weniger als 20 Prozent der Unternehmen erfüllten die Vorgaben. Auch bei der zweiten Befragung galten deutlich weniger als 50 Prozent der Unternehmen als sogenannte Erfüller.
Wer Schäden anrichtet, muss dafür Verantwortung übernehmen – das gilt auch für Unternehmen. In den vergangenen Jahren ereigneten sich weltweit immer wieder Katastrophen, an denen deutsche Unternehmen durch ihre Geschäftstätigkeit direkt oder indirekt beteiligt waren.
Weltweit müssen 160 Millionen Kinder laut Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) unter Bedingungen arbeiten, die sie ihrer elementaren Rechte und Chancen berauben. 79 Millionen von ihnen leiden unter Arbeitsbedingungen, die gefährlich oder ausbeuterisch sind. Die Verletzung von Menschenrechten darf kein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen sein. Die Rechte von Betroffenen müssen besser geachtet werden. Betroffene von Menschenrechtsverletzungen brauchen Zugang zu Gerichten.
Deutschland ist nach den USA und China das drittgrößte Importland und hat damit einen wichtigen Stellenwert im globalen Lieferkettennetzwerk. Deutschland sollte als Vorreiter Verantwortung übernehmen.
Mehr als 80 Unternehmen sprachen sich für ein Sorgfaltspflichtengesetz aus. Über 220.000 Deutsche forderten im Juli 2020 in einer Petition an die damalige Bundeskanzlerin ein Sorgfaltspflichtengesetz für Deutschland. Der Rat für nachhaltige Entwicklung hat der Bundesregierung empfohlen, eine Vorreiterrolle bei der europäischen Gesetzgebung einzunehmen.
In der Demokratischen Republik Kongo gehen viele Kinder vormittags zur Schule und arbeiten nachmittags in einer Mine, um ihre Familien zu unterstützen.
Häufig genannte Irrtümer über das Gesetz
„Deutschland will überall in der Welt die Einhaltung deutscher Sozialstandards erzwingen.“
Richtig ist: Es geht nicht um die Durchsetzung deutscher Vorgaben, sondern um die Einhaltung grundlegender und international anerkannter Menschenrechtsstandards.
„Der Staat schiebt die Verantwortung auf Unternehmen ab.“
Richtig ist: Der Schutz der Menschenrechte liegt in gemeinsamer Verantwortung von Staaten und Unternehmen. Es kommt auf die richtige Mischung zwischen freiwilligen und verbindlichen Ansätzen an und das Lieferkettengestz ist Teil davon.
„Bei Verstößen droht den Unternehmen strafrechtliche Verfolgung“
Richtig ist: Niemand muss ins Gefängnis. Ein Verstoß gegen die Berichtspflicht führt zu üblichem Bußgeld. Das Gesetz schafft keine neuen zivilrechtlichen Haftungsregelungen. Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften steht kein eigenes Klagerecht zu, sie können betroffene Personen nur bei ihrer Klage unterstützen.
„Das Gesetz benachteiligt deutsche Unternehmen.“
Richtig ist: Ein Sorgfaltspflichtengesetz schafft Wettbewerbsgleichheit unter deutschen Unternehmen. Um ein faires Geschäftsumfeld für alle herzustellen, wird parallel auch an einem EU-Rechtsrahmen und Regeln auf UN-Ebene gearbeitet.
„Das Gesetz schafft bei Unternehmen ein neues Bürokratie-Monster und verursacht höhere Kosten.“
Richtig ist: Das Gesetz verlangt ein systematisches Risikomanagement und die Unternehmen sollen elektronisch an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA ) berichten, das die Angaben überprüft. Bestehende Berichtspflichten, beispielsweise im Rahmen der CSR-Richtlinie, werden berücksichtigt. Zudem hat eine Studie der EU-Kommission berechnet, dass die Kosten für Großunternehmen bei nur durchschnittlich 0,009 Prozent des Umsatzes liegen.
„Das Gesetz belastet kleine und mittlere Unternehmen (KMUs).“
Richtig ist: KMUs fallen nicht unter den Anwendungsbereich des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, zunächst sind nur Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten davon unmittelbar betroffen (ab 2023), in einem weiteren Schritt (ab 2024) dann Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten.
„Deutsche Unternehmen unterliegen dadurch Doppelbelastungen in bestimmten Sektoren.“
Richtig ist: Die Umsetzung des Gesetzes berücksichtigt bestehende Regelungen und auch zukünftige europäische Regelungen werden entsprechend integriert werden.
„Das Gesetz hätte zur Folge, dass deutsche Unternehmen sich aus Entwicklungsländern zurückziehen werden.“
Richtig ist: Das Gesetz soll explizit den Grundsatz „Befähigung vor Rückzug“ befördern und die Bundesregierung wird Unternehmen dabei unterstützen, die Vorgaben – auch in Entwicklungsländern – umzusetzen.
Stand: 26.04.2023