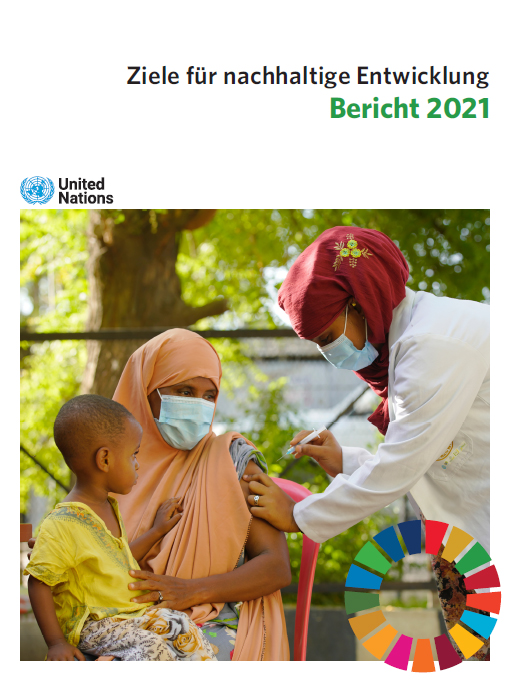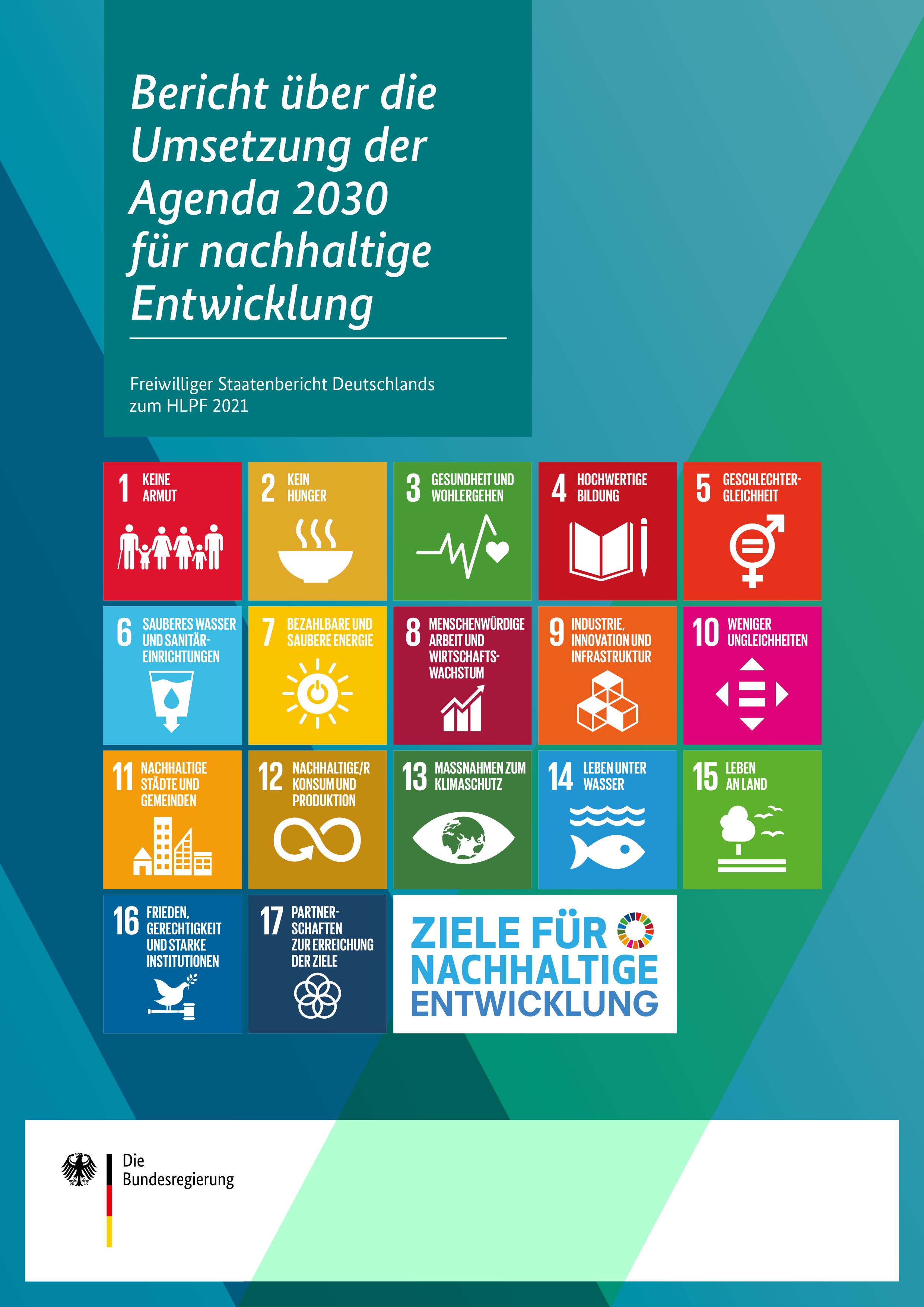Immer besser werden: Die Wirksamkeit der Zusammenarbeit erhöhen
Frauen der „Wise Women Plumbers Cooperation“ bei der Säuberung eines Wasserspeichers in Jordanien
Wirkungsorientierung
Wirkungsorientierung ist für das BMZ von zentraler Bedeutung. Die Herausforderungen in der Welt sind groß. Gleichzeitig sind die finanziellen Mittel begrenzt. Wie kann beispielsweise Hunger möglichst wirksam gelindert werden?
In die Planung entwicklungspolitischer Vorhaben fließen daher Erfahrungen mit bewährten Ansätzen ein. Es wird klar definiert, welche Ergebnisse erzielt werden sollen.
Außerdem werden für jedes Projekt SMARTe (spezifische, messbare, erreichbare, relevante und terminierte) Indikatoren festgelegt, mit denen der Projektfortschritt erfasst wird. Zeichnet sich im Projektverlauf ab, dass angestrebte Wirkungen nicht erzielt werden können, wird das Projekt entsprechend umgesteuert.
Evaluierungen
Das Ministerium stellt die eigenen Vorhaben ständig auf den Prüfstand. Durch systematische Analysen und Bewertungen von entwicklungspolitischen Projekten, Programmen, Instrumenten und Strategien (Evaluierungen) wird überprüft, ob und wie Entwicklungsziele erreicht wurden und ob sie als erfolgreich gelten können.
Stark vereinfacht geht es dabei immer um die Fragen „Was ist dabei herausgekommen?“ und „Was können wir in Zukunft besser machen?“
Transparenz
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches entwicklungspolitisches Engagement ist Transparenz. Das Bundesentwicklungsministerium orientiert sich dabei an international vereinbarten Standards.
Über sein Transparenzportal (Externer Link) informiert das BMZ die Öffentlichkeit, wofür es seine Mittel ausgibt und wohin diese fließen. Dieselben Informationen werden zusätzlich über eine englischsprachige Plattform (Externer Link) der internationalen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Die Offenlegung der Projektdaten macht die deutsche Entwicklungszusammenarbeit nachvollziehbar und vertrauenswürdig. Der transparente Umgang mit den Informationen stärkt die Eigenverantwortung der Partnerregierungen, ermöglicht eine bessere Koordination zwischen den Gebern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), mindert das Risiko von Missbrauch und Korruption, erleichtert das Lernen und Verbessern – und erhöht somit die Wirksamkeit der Entwicklungspolitik.
Internationale Kooperation
Auch auf internationaler Ebene wird intensiv daran gearbeitet, die Entwicklungszusammenarbeit so wirksam wie möglich zu gestalten. Herzstück der sogenannten „Wirksamkeitsagenda“ sind die 2005 verabschiedeten und zuletzt 2011 überarbeiteten Wirksamkeitsprinzipien:
- Eigenverantwortung der Partnerländer (Ownership (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)): Partnerländer setzen ihre eigenen nationalen Entwicklungsprioritäten; die Entwicklungspartner passen ihre Unterstützung entsprechend an und nutzen örtliche Strukturen und Systeme.
- Ergebnisorientierung: Partnerländer und Geber konzentrieren sich auf Ergebnisse, die langfristige Wirkung entfalten.
- Inklusive Partnerschaften: Zusammenarbeit zwischen Partnerländern, Gebern, Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und der privaten Wirtschaft.
- Transparenz und gegenseitige Rechenschaftspflicht: Offenlegung von Informationen zur Stärkung von Vertrauen und Rechenschaft durch Partnerländer und ihre Entwicklungspartner.
2012 wurde die Globale Partnerschaft für wirksame Entwicklungszusammenarbeit (Global Partnership for Effective Development Co-operation (Externer Link), GPEDC) gegründet. Sie vereint staatliche und nicht staatliche Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft im Globalen Süden und Norden (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen). Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht der Austausch über bewährte Verfahrensweisen, um die Umsetzung der Wirksamkeitsprinzipien zu begleiten und zu überprüfen. Damit leistet die GPEDC einen wichtigen Beitrag zur Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen), insbesondere zum globalen Entwicklungsziel 17 (Externer Link)(„Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“).